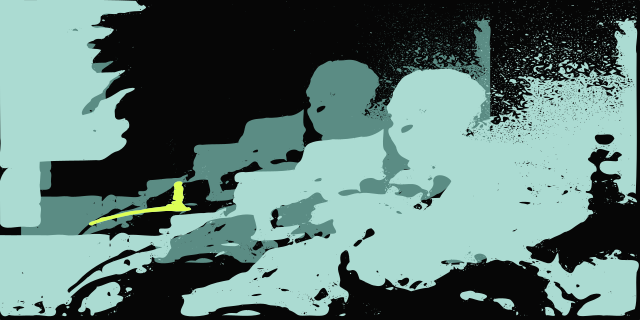von Herbert Ammon
Schadenfreude, sprachlich abgemildert Genugtuung, reicht allein nicht aus, um die Umstände des Auftritts und Abgangs des Christian Wulff zu kommentieren. Doch sei ohne Selbstlob vermerkt, dass am 23. Juni 2010, anlässlich der trick- und erfolgreichen Durchsetzung Wulffs als Bundespräsidenten durch die Bundeskanzlerin Merkel und ihrer damaligen koalitionären Entourage in Globkult ein Aufsatz von Ulrich Schödlbauer erschien, der das politische Getriebe – genauer: das von Volkes Willen ungestörte Gebaren der politischen Klasse – auf den Begriff brachte:
Schödlbauers Gaukel-Spiel handelte von der Entmachtung des Souveräns (= das »Volk«, obendrein das in der Präambel großgeschriebene »Deutsche Volk«) im politischen System der Bundesrepublik, das die Ausübung politischer Gewalt laut Art. 20,2 GG (»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«) demokratisch legitimiert und den Parteien im Wortlaut von Art. 21,1 GG nur die »Mitwirkung« an der politischen Willensbildung des Volkes zuerkennen will. Es handelte von der Missachtung des Art. 146 GG beim ›Beitritt‹ der DDR gemäß dem post eventum eilends umformulierten Art. 23 GG, von der Verweigerung von Volksabstimmungen bei den grundlegend verfassungsändernden EU-Verträgen, zuletzt beim Lissabon-Vertrag (in Kraft gesetzt am 1.12.2009), allgemein von der autoritären Signatur der Politik »in unserem Lande« und von der Selbstgefälligkeit der politischen Klasse im Parteienstaat.
Nun mag es als Binsenweisheit gelten, dass Verfassungsideal und Verfassungswirklichkeit nicht nur in Bananenrepubliken, sondern auch in jedem westlichen Staat auseinanderfallen, dass die demokratische Verfassungstheorie zwar in der Metaphysik der ›Volkssouveränität‹ wurzelt, dass aber die Umsetzung des hehren Prinzips – anders als dessen historisches Gegenstück: die in persona fassbare monarchische Souveränität – in die politische Praxis nicht ohne weiteres möglich scheint. Seit Montesquieus Geist der Gesetze und Rousseaus Gesellschaftsvertrag wogt der Streit über die ›richtige‹ Umsetzung des Prinzips. »Alle Macht geht vom Volke aus – aber wo geht sie hin?«, fragte dereinst Kurt Tucholsky.
Skepsis scheint geboten angesichts historischer Erfahrungen mit revolutionären ›Volkskommissaren‹, mit ›Volksgerichtshöfen‹ und ›Volksdemokratien‹. Immerhin zeigen die plebiszitären Verfahren in der Schweiz, dass direkte Demokratie ja durchaus praktikabel ist. Anders in den Staaten der EU, wo das ›Volk‹ in den Referenden über die (fast) alle Macht nach Brüssel verlagernden Verträge nicht zustimmen wollte, die Volksabstimmungen solange wiederholt wurden, bis sie stimmten. Als besonders lernfähig bezüglich der Unberechenbarkeit des Volkes erwiesen sich fraglos die Grünen, die einst angetreten im Zeichen von Basisdemokratie und Volksentscheiden von der derlei gefährlichen Spielchen längst nichts mehr wissen wollen. Trittin, Roth und Özdemir – im besten Einklang mit den anderen Mitwirkenden – wissen ziemlich genau, was das ›Volk‹ über die Brisanz der multiethnischen Utopie denkt. Sie beschränkten sich darum schon frühzeitig auf Umdeutung der ›Volkssouveränität‹ zur Quotendemokratie.
Nichtsdestoweniger bleibt das ›Volk‹ auch in liberalen Demokratien – siehe oben GG – das corpus mysticum politischer Gewalt. Das Grundgesetz billigt dem Volk ausdrücklich im genannten Art. 20, 2 zur Ausübung seines auktorialen Rechtes »Souveränität« außer Wahlen auch »Abstimmungen« zu. In praxi ist davon auf Bundesebene nicht das geringste je verwirklicht worden. Zyniker, die in Deutschland nicht selten als Chefmoralisten auftreten, mögen meinen, das sei auch gut so. Im übrigen wisse man ja, wohin das ganze führe: von der Weimarer Verfassung über Hindenburg zu Hitler.
Plebiszite seien die Einladung zur Demagogie, befand ehedem Theodor Heuß. Das entspricht ungefähr dem heutigen politischen Bildungsstand des intellektuell anspruchsvolleren bundesrepublikanischen Normal- und Neubürgers, wonach Hitler irgendwann direkt von ›den Deutschen‹ gewählt und/oder die NSDAP bei diversen Wahlen die absolute Mehrheit gewonnen habe. Nun ist es richtig, dass in der Weimarer Verfassung die Parteien nicht erwähnt waren. Dennoch übten sie – unbeschadet von der starken Position des mit des Volkes Souveränität direkt ausgestatteten Reichspräsidenten – erhebliche Macht aus. Den legalen Übergang zur Hitler-Diktatur vermittels des Ermächtigungsgesetzes vollzogen – unter welchen Umständen immer und mit der rühmenswerten Ausnahme der SPD – die Parteien am 23. März 1933 in dem in der Krolloper tagenden Reichstag. Der Abgeordnete der liberalen Deutschen Staatspartei Theodor Heuß beugte sich wider bessere Erkenntnis dem Fraktionszwang und stimmte der Suspendierung der Verfassung zu.
Die »Väter und Mütter« des Grundgesetzes, so heißt es, wollten uns vor neuerlichem Unheil bewahren, indem sie die Parteien in Verfassungsrang erhoben, die Machtbefugnisse des Bundespräsidenten minimierten und selbst die Wahl des höchsten Repräsentanten des Staates nicht dem Volk, sondern einer ›Bundesversammlung‹ anvertrauten. Immerhin zogen die historisch mehr oder minder NS-geschädigten Österreicher eine andere Lehre aus der Geschichte und überließen in ihrer föderalen Verfassung die Wahl des Bundespräsidenten weiterhin dem Volke selbst. Felix Austria.
Im bundesdeutschen Parteienstaat hat das souveräne Volk sich der Weisheit der politischen Klasse und ihrer Strippenzieher zu fügen. Womit wir bei der Wiederaufführung des Gaukelspiels sind.
Das Spiel begann anno 2010 mit einem Eklat, als der von Volkes Sympathie getragene Horst Köhler aus unerfindlichen Gründen – angeblich wegen der beleidigenden Rhetorik Trittins – zurücktrat. Unter der Regie der Kanzlerin Merkel geriet es zur Farce, als diese – dereinst FDJ-Sekretärin, später Kohl-Königsmörderin – anstelle des ihr aus DDR-Zeiten als unangepasst und unbeugsam bekannten Gauck den Wulff ins Schloss Bellevue lancierte. In salbungsvollen Worten, in brav eingeübten Auftritten, tat Wulff, was die politisch-mediale Klasse (und Merkel) gebot.
Womöglich hätte den Bundespräsidenten Wulff seinerzeit – bereits ein halbes Jahr nach der Wahl – Thilo Sarrazin mit einer Klage gegen seine von Wulff geforderte Amtsenthebung bei der Bundesbank zu Fall bringen können. So mussten die Bürger als Zuschauer noch eine längere Szenenfolge mit Wulff, Tochter und Gattin ertragen, bis die List der Vernunft der Inszenierung ein Ende bereitete. Wie und warum die BILD-Zeitung Merkels Wulff zu Fall brachte, bleibt in dem ganzen Spiel ein Rätsel. Unvergesslich bleibt die rhetorische Glanzleistung Wulffs: »Für mich ist der Rubikon überschritten.« Wulffs Abgang aus Schloss Bellevue entsprach sodann wiederum seinem histrionischen Mittelmaß.
Philipp Rösler und Rainer Brüderle sei Dank. Der lautstarke Auftritt der Kanzlerin blieb dem Publikum leider verborgen, allerdings drang der Rumor übers Internet und die Medien bis hinauf in den Olymp. Dem Volk, dem Souverän, blieb bei der Aufführung des bundesrepublikanischen Parteienstaates, des peinlichen Lustspiels um Merkels Wulff, nur der Platz im Zuschauerraum. Was dem citoyen als Zuschauer bleibt, ist Schadenfreude. Er blickt erwartungsvoll auf die so unerwartete, von Merkel und manch anderen unerwünschte Wiederkehr Gaucks auf die Berliner Bühne.