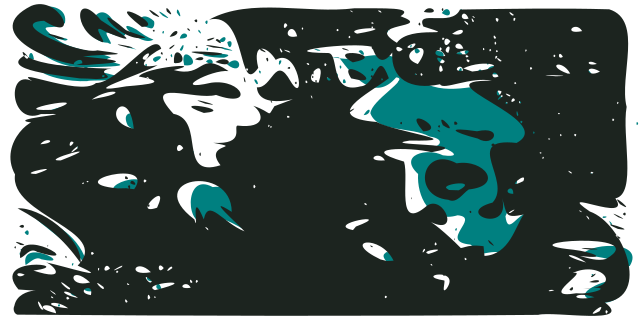von Jörg Büsching
Wer in den letzten Wochen die Affäre um unseren Verteidigungsminister und seinen regelwidrig erworbenen Doktorgrad der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth verfolgt hat, konnte Zeuge eines merkwürdigen Widerspruchs in der öffentlichen Wahrnehmung werden, der durchaus signifikante Einsichten über die weitere Entwicklung der deutschen Demokratie bereithalten könnte, wurde doch Guttenberg zeitweise bereits als künftiger Kanzler des Landes gehandelt.
Einer ganzen Serie vernichtender Artikel und Kommentare fast aller großen deutschen Zeitungen standen von der Boulevardpresse zumindest sekundierte – zum Teil auch lancierte – Umfragen hinsichtlich der zu ziehenden politischen Konsequenzen gegenüber, die sich mit großer Mehrheit zugunsten des Verteidigungsministers aussprachen. Auf den ersten Blick scheint hier eine elitäre, »linke« (wie der am häufigsten zu lesende Vorwurf lautet) Medienmacht sich gegen einen »im Volk« beliebten Politiker in Stellung gebracht zu haben. So unsinnig dieser Vorwurf auch ist, hinterließ die trotz aller durchsichtiger Winkelzüge und halbgarer Entschuldigungen des Freiherrn nicht nachlassende, demoskopisch festgestellte »Beliebtheit« bei dem ein oder anderen Journalisten letztendlich doch auch eine gewisse Ratlosigkeit, wie der »Fall Guttenberg« nun zu bewerten sei. Wer möchte sich schon gerne den Ruf einhandeln, undemokratisch zu sein und gar als »neidgeplagter«, ewig nörgelnder »Linker« abgestempelt zu werden? Nicht so ganz ins Bild scheint hierbei zu passen, dass ausgerechnet die liberal-konservative FAZ ganz vorne in den Reihen der Guttenberg-Kritiker anzutreffen war. Ein Grund hierfür mag sicherlich die von den deutschen Verlegern angestrebte Reform des Urheberrechts sein, die der Freiherr mit seiner dreisten Kopiertechnik höchst wirksam ad absurdum geführt hat.
Dass dies aber bei weitem nicht der einzige und womöglich nicht einmal der ausschlaggebende Grund ist, offenbart sich beim Blick in die Leserkommentare der Online-Ausgaben der Zeitungen, und hier wieder vor allem jener der FAZ. Dort zeigt sich nämlich, dass Leser, die sich selbst dem »bürgerlich-konservativen« Lager zuordnen, besonders hart mit Guttenberg ins Gericht gehen. Das ist durchaus verständlich, gilt doch gerade ihnen das von der gegenwärtigen Regierung zur obersten Maxime erhobene ›Leistungsprinzip‹ als Ausweis der Legitimität des eigenen gesellschaftlichen Status. Demgegenüber finden sich unter den Befürwortern des Verteidigungsministers vor allem solche, die es nach eigenem Bekunden weder mit den Regeln wissenschaftlichen Arbeitens im Besonderen noch mit der Ehrlichkeit im Allgemeinen allzu genau nehmen.
Die Diffamierung der bürgerlichen Kritiker als selbstherrliche Moralapostel, und der Zynismus, mit dem Guttenbergs Vergehen entschuldigt oder sogar gerechtfertigt wird, kennzeichnet einen erklecklichen Teil der Apologien als kleinbürgerliche Ressentiments. Dies im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Umfragen gesehen, legt den Schluss nahe, dass die Anhänger des Verteidigungsministers in der Masse genau jener Schicht angehören, die sich einerseits zu den »Leistungsträgern« der Gesellschaft zählt, weil sie die finanzielle Hauptlast des Gemeinwesens zu tragen hat, während sie andererseits zusammen mit den einfachen Arbeitern (mit denen sie sich freilich keinesfalls gemein machen will) zu den »Verlierern« der Globalisierung gehört. Anders ausgedrückt dürfte es sich in der Mehrzahl um jene Schicht handeln, die im Zuge des industriellen Nachkriegsbooms aufgestiegen ist, indem sie die in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angestoßenen Bildungsreformen genutzt hat. ›Bildung‹ ist seit dieser Zeit vor allem (wenn nicht sogar ausschließlich) berufsvorbereitende Ausbildung, während moralische, ästhetische oder, allgemein gesprochen, kulturelle Bildung weitestgehend als Privatsache abgetan wird.
Ein fränkischer Gutsherr als Idol des Kleinbürgertums? Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, sobald man das Image Guttenbergs betrachtet. Von Anfang an wurde er als Typus des »Anti-Politikers« aufgebaut, der in der Welt der Formelkompromisse und faulen Ausreden »Klartext« redet und sich von intriganten Amtsinhabern und bürokratischen Apparatschiks nicht aufs Kreuz legen lässt, sondern, wenn nötig, »konsequent durchgreift«. Dass dabei, wie bei seiner Dissertation, Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen, stört den von akuten Abstiegsängsten, heimlichem Groll gegen ›die da oben‹ und abgrundtiefem Neid auf alle, die es vermeintlich leichter haben (sowohl die eigentlichen Profiteure der Globalisierung, also Leute mit hohem Kapitaleinkommen, als auch das vom Staat gepäppelte Prekariat), geplagten Kleinbürger nicht. Er verachtet das harte Brot der demokratischen Willensbildung und sehnt sich stattdessen wie eh und je nach der einen Lichtgestalt, die, wenn sie ihn schon nicht aus der aschgrauen, kalten Hölle seines alltäglichen Daseins zu erlösen vermag, wenigstens ein wenig Glamour abstrahlt, in dem man sich sonnen kann. Die Ähnlichkeit zwischen Guttenberg und dem Phänomen Berlusconi kann einem wachen Beobachter des Zeitgeschehens kaum verborgen geblieben sein.
Doch bei aller Ähnlichkeit zwischen unserem Verteidigungsminister und dem italienischen Ministerpräsidenten, der sein Volk schon seit siebzehn Jahren mit populistischen Parolen und einer höchst eigenwilligen Auffassung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Bann hält, sollte man mit Blick auf die mögliche Entwicklung der nächsten Jahre auch die Unterschiede berücksichtigen.
1. Guttenberg verfügt nicht über dieselbe Unabhängigkeit wie der »Cavaliere«, denn die Medienmacht, die ihn stützt, allen voran der Axel Springer Verlag, gehört nicht ihm, vielmehr gehört er ihr. – Der Versuch als Wirtschaftsminister, auf seine angeblich vorhandene unternehmerische Kompetenz zu verweisen um eigenständiges Profil zu erlangen, scheiterte kläglich.
2. Die Durststrecke bis zu einer möglichen Kanzlerschaft könnte noch sehr lang werden. Dass Angela Merkel das Zepter freiwillig schon zum nächsten Wahltermin an ihn übergibt, ist zumindest aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Darüber hinaus stehen dem natürlich auch die unterschwelligen Rivalitäten zwischen den beiden »Schwesterparteien« CDU und CSU entgegen – und Guttenberg ist gewiss kein Franz Josef Strauß.
Punkt eins bedeutet, dass ihm die Sympathie der Boulevardpresse, die jetzt noch uneingeschränkt auf seiner Seite ist, ohne weiteres wieder entzogen werden kann. (Unvergessen beispielsweise das Foto Helmut Kohls als »Umfaller« auf der Titelseite der BILD-Zeitung, als dieser seine vollmundigen Zusagen bezüglich der Finanzierung der deutschen Einheit revidieren musste.)
Entscheidend ist aber Punkt zwei, denn die politische Karriere lässt sich aus seiner Position heraus nicht allein mit Glamour und Rhetorik gestalten. So muss sich z. B. der Erfolg der Bundeswehrreform erst noch zeigen. Seine bisher vorgelegte Arbeit hierzu konnte ja nicht einmal die eigenen Kabinettskollegen überzeugen.
Die Aussetzung der Wehrpflicht hat Guttenberg vor allem bei jungen Männern, die diesen Dienst nun nicht mehr leisten müssen und deren Eltern, die nicht mehr befürchten müssen, dass ihre Kinder sich unversehens in irgendwelchen Krisengebieten wiederfinden, Sympathien zugetragen. Ob sich aber auf lange Sicht genügend Freiwillige – vor allem für die Mannschaftsdienstgrade – rekrutieren lassen, um die Einsatzfähigkeit der Armee in ihrem jetzigen Aufgabenfeld als global einsetzbare Interventionsarmee zu gewährleisten, ist bei einer alternden Bevölkerung und einer Wirtschaft, die schon jetzt über Fachkräftemangel klagt, eher fraglich. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht aber würde denjenigen, der dies versucht, politisch Kopf und Kragen kosten, insbesondere, wenn absehbar wäre, dass sie nicht dazu dient, irgendeine existenzielle Bedrohung von Deutschland abzuwenden, sondern die ausländischen Kapitalinteressen einiger weniger Konzerne zu schützen, die im Gegenzug Steuern vermeiden, Arbeitsplätze abbauen und Lohndumping betreiben.
Zur Zeit kann Guttenberg noch mit publikumswirksamen Besuchen bei der kämpfenden Truppe punkten. Ist diese jedoch erst »professionalisiert«, werden Bundeswehr und deutsche Mehrheitsgesellschaft sich noch weiter entfremden, als das heute schon der Fall ist. Anders als in den USA und Großbritannien fehlt dem Militär in Deutschland nämlich der Nimbus einer die Freiheit der Nation verteidigenden Macht, den die britischen und amerikanischen Streitkräfte aus dem Zweiten Weltkrieg in die Gegenwart gerettet haben. Ein solches ›symbolisches Kapital‹ (Bourdieu) lässt sich nicht durch Werbeaktionen oder glamouröse Fernsehauftritte herstellen, und ein Popanz der dem ähnlich sähe, würde bei der ersten harten Probe in sich zusammenfallen. Das könnte dann radikalen Kräften Stoff für künftige ›Dolchstoßlegenden‹ liefern und die Spaltung der Gesellschaft, die in der öffentlichen Aufarbeitung dieser Affäre bereits deutlich zutage getreten ist, weiter vertiefen.
Der Irrtum Guttenbergs und seiner Förderer liegt darin, dass sie glauben, hinter den Sympathien, die dem Verteidigungsminister zur Zeit zufliegen, stecke echte Loyalität, die zu mehr als günstigen Umfragewerten taugt. Ebendeshalb ist er für die Kanzlerin unersetzlich. Mit den Mitteln der PR soll versucht werden, die Bevölkerung in eine Richtung zu lenken, von der sie sich zweifellos entsetzt abwendete, sobald man wirklich anfangen würde ›Klartext‹ zu reden.