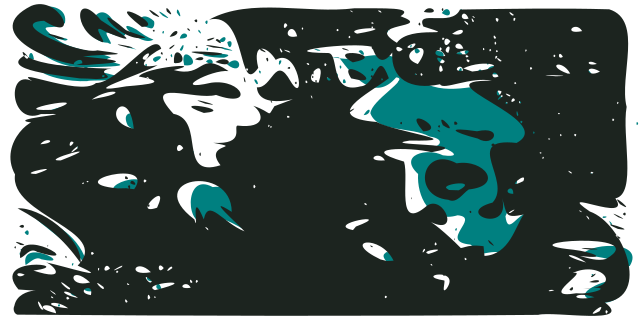von Boris Blaha
In den vielen, meist nachdenklichen Aufarbeitungen der Demonstrationen in Berlin am 1. und 29. August wurde, mal mit mehr melancholischem, mal mit mehr optimistischem Grundton, auf das ›bunte Völkchen‹ verwiesen, die naiv-romantische Festivalstimmung wurde ebenso hervorgehoben wie der fehlende politische Ernst. Insgesamt vermisste man die mangelnde Orientierung und Ausrichtung auf einen klaren politischen Gegner. Das Volk müsse sich erst finden, hieß es.
Das ist alles richtig, dennoch fehlen mir in diesen Beschreibungen zwei wesentliche Aspekte. 1989 gab es eine östliche und eine westliche Wahrnehmung und zwischen beiden eine große Verständnislosigkeit. Nach der erfolgreichen Delegitimierung der bloß angemaßten ›führenden Rolle der Partei‹ durch das ›wir sind das Volk‹ änderte sich die Perspektive: Mit dem ›wir sind ein Volk‹ erging die Aufforderung an die westlichen Landsleute, den Verfassungsauftrag des Grundgesetzes anzunehmen, was am lautesten die 68er Generation, die sich mit der Flucht aus der geschichtlichen Verantwortung profitable Positionen gesichert hatte, mit konsequenter Verweigerung quittierte. Otto Schilys peinlicher Bananenauftritt dürfte noch vielen in Erinnerung geblieben sein. Christian Meier gehörte damals zu den wenigen herausragenden öffentlichen Intellektuellen, die sich unermüdlich, aber weitgehend vergeblich darum bemühten, ein Gespräch in Gang zu bringen.
Gut dreißig Jahre später hat sich einiges verändert. Es beginnt sich eine, an markanten Symbolen wie DDR 2.0 verdichtete, gemeinsame gesamtdeutsche Wahrnehmung der Lage des Landes abzuzeichnen. Während die Erfahrung der Kluft zwischen erfahrbarer Wirklichkeit und medial vermittelter Realität für Ostdeutsche schon so selbstverständlich ist, dass sie über ein gut eingeübtes Lesen zwischen den Zeilen verfügen, müssen wohlstandsverwöhnte Westdeutsche eine für sie neue Erfahrung erst noch verarbeiten. Einen derart rapiden Autoritätsverlust vor allem öffentlich-rechtlicher Medien hat es in der Nachkriegsrepublik noch nie gegeben. Die Folge: Man tauscht sich jetzt aus. Die 1989 aus westlicher Perspektive irritierende Erfahrung der ›unterbrochenen Revolution‹ bekommt allmählich jene ihr zustehende Bedeutung, die die ungarische von 1956 im Gedächtnis der Ungarn immer schon hatte, eine späte Genugtuung für die, die damals viel riskiert haben und es heute wieder tun. Wer gegenüber wem was nachzuholen hätte, ist heute deutlich offener, als in der Phase westlicher Arroganz.
Die weit verbreitete Brandtsche Metapher vom ›jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört‹ ließ das Missverständnis eines quasi natürlichen Prozesses zu, der ganz ohne unser Zutun schon in die richtige Richtung ablaufen würde. Heute sieht man klarer: Die langsam entstehende gemeinsame gesamtdeutsche Wahrnehmung überspringt die Jahrzehnte der deutschen Teilung und knüpft damit an die letzte gesamtdeutsche Wahrnehmung an, die der ersten Besatzungsjahre vor der Aufspaltung in West und Ost. Die Zwischenphase, die ja nicht nur die strikte Teilung der deutschen Geschichte beinhaltete, sondern ebenso das geheime Einverständnis zwischen den Sozialisten im Osten und denen im Westen, mit den totalitären Einbrüchen nichts zu tun zu haben, wird damit beendet. Die weitreichende politische Bedeutung einer solchen Wiederanknüpfung an gesamtdeutsche geschichtliche Kontinuitäten ist gegenwärtig noch gar nicht klar auszuloten. Deutlich ist jedoch: Die 68er, deren prägender Kern die Verweigerung der Verantwortung gewesen ist, geraten immer mehr ins defensive Abseits, was die Vehemenz verständlich macht, mit der sie sich an einer verlorenen Sache festklammern. Die Strategie des Westens, 1989 so weiterzumachen, als sei nichts geschehen, erweist sich als Sackgasse.
Der zweite, vielleicht noch wichtigere Aspekt bezieht sich auf etwas, was für Engländer seit Jahrhunderten selbstverständlich, für Deutsche aber etwas gänzlich Neues ist. Wahrscheinlich zum allerersten Mal in der deutschen Geschichte entsteht eine gemeinsame und massenfähige Wahrnehmung von der Bedeutung eines stabilen Rechtswesens, dem, was die Engländer die ›rule of law‹ nennen. Das gegenwärtige Messen mit zweierlei Maß ist so offenkundig, dass man gezielt wegschauen muss, um nicht zu bemerken, dass hier etwas Grundlegendes aus den Fugen gerät, was jahrzehntelang Stabilität garantierte. Das Herrschen per unbegründetem Notstand ruft den verbreiteten Wunsch nach einer Rückkehr zum guten alten Recht hervor.
Die politisch klügeren Engländer, die an entscheidenden Momenten ihrer Geschichte rechtzeitig selbstherrlich, absolutistische Ansprüche begrenzt haben, sind damit über all die Jahrhunderte besser gefahren als der Kontinent, der bis heute immer wieder der Illusion souveräner Herrschaft anheimfiel und extrem hohe Preise dafür bezahlt hat. Alleine schon aufgrund dieser Erfahrungen wäre eine Verschiebung der Perspektive von den jakobinisch-bolschewistischen zu den politischen Revolutionen überfällig.
Eine gesamtdeutsche Bewegung, die sich im Bemühen, sich über sich selbst Klarheit zu verschaffen, in die politischen Revolutionsgeschichten Mitteleuropas einfädelt, wäre ein hoffnungsvoller Anfang. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Präsident Litauens, Vytautas Landsbergis, nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit, einer der ersten war, der öffentlich vor einem erneutem Abgleiten Westeuropas in den Sozialismus gewarnt hat.