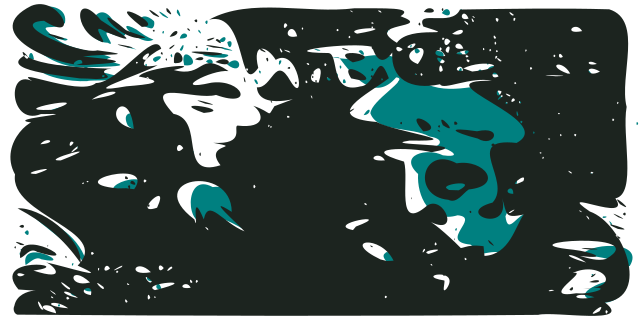von Peter Brandt
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Großen Kreisstadt Backnang, liebe Landsleute, meine Damen und Herren!
Ihr geschätzter Oberbürgermeister Dr. Nopper hat mich in Verbindung mit meinem Freund Robert Antretter eingeladen, heute Vormittag zu Ihnen zu sprechen: an unserem Nationalfeiertag, dem Tag, an dem vor 29 Jahren die staatliche Einheit Deutschlands nach vierzig Jahren Teilung und Zweistaatlichkeit wieder hergestellt wurde durch Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Ich bin kein Volksredner, und wenn ich Vorlesungen oder Vorträge halte, dann üblicherweise in geschlossenen Räumen. Auch wenn ich hier kein akademisches Kolleg abhalten will, wird wohl ein wenig meine – auch berufliche – Prägung durchschimmern.
Zunächst meinen Respekt, werte Anwesende, für die Art und Weise, wie Sie den 3. Oktober begehen! Wenn ich das viele Schwarz-Rot-Gold, die deutschen Farben, unsere Trikolore, sehe, kann ich indessen meinen Kummer darüber nicht unterdrücken, dass viele unserer Mitbürger, vor allem in den jüngeren Altersgruppen, nationalistische und reaktionäre Inhalte vermuten, wenn sie Schwarz-Rot-Gold sehen. Sie scheinen von der Geschichte des Dreifarbs nichts zu wissen: beginnend mit den Freiwilligen-Einheiten der antinapoleonischen Befreiungskriege und der Urburschenschaft über das Hambacher Fest hin zur ersten deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche und der dort ausgearbeiteten fortschrittlichen Verfassung, vereitelt von der wieder erstarkten Fürstenmacht, nicht zu vergessen der erbitterte Symbolkrieg 1918 zwischen dem Schwarz-Rot-Gold der Republikaner und dem Schwarz-Weiß-Rot der Monarchisten und Rechtsnationalisten.
Manche halten den 3. Oktober nicht für den geeignetsten Nationalfeiertag: Es war ein vertraglich festgelegtes Stichdatum, das naturgemäß weniger Gefühle mobilisiert als der 9. November, der Tag der Maueröffnung, dessen dreißigster Wiederkehr wir in gut einem Monat begehen. Als alter Berliner, der im Kindesalter noch die Freizügigkeit in der ganzen Stadt erlebt, als Zwölfjähriger die Befestigung der innerstädtischen Grenze beobachtet und im Erwachsenenalter viele Jahre darüber nachgedacht hatte, wie die Teilung meiner Heimatstadt und die Teilung unseres Landes überwunden werden könnten, war es für mich ein großes Glück, dieses monströse Bauwerk, Symbol des Kalten Krieges und des Kalten Bürgerkriegs in Deutschland, fallen zu sehen – und zwar nicht in Schutt und Asche.
Es ist unter Experten wenig umstritten, dass die westliche, insbesondere bundesdeutsche Entspannungspolitik, die sich im Verlauf der 1960er Jahre von verschiedenen Ausgangspunkten her, darunter einem Westberliner, herauskristallisierte, eine der wesentlichen Voraussetzungen (nicht die einzige) für die Beendigung des alten Ost-West-Konflikts und in diesem Zusammenhang für die Wieder- oder Neuvereinigung Deutschlands war. Diese Politik wurde in den Jahren der ersten Großen Koalition 1966 bis 1969 vorbereitet, um 1970 zur Zeit der sozialliberalen Koalition von der Regierung Brandt/Scheel durchgekämpft und ab 1982 von der Regierung Kohl/Genscher im Wesentlichen fortgesetzt.
Der enge und außenpolitisch wichtigste Berater Helmut Kohls, Horst Teltschik, unterstreicht heute die Bedeutung der Entspannungspolitik der 70er Jahre dafür, dass ein Mann wie Michail Gorbatschow an die Spitze der sowjetischen Weltmacht gelangen und eine ganz neue Außenpolitik einleiten konnte. (Ich will nicht unterschlagen, dass es unter damals Beteiligten wie unter Wissenschaftlern auch kontroverse Diskussionen gab und gibt, so über den Stellenwert der sogenannten NATO-Nachrüstung in den frühen 1980er Jahren.)
Teltschik, dieser Ausflug in die Tagespolitik sei gestattet, mahnt auch mehr Verständnis für das heutige Russland an, das territorial auf Grenzen ähnlich denen im 17. Jahrhundert zurückgeworfen ist. Politische Freiheit in unserem Verständnis hat in Russland niemals geherrscht mit Ausnahme der wenigen Monate zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution 1917. Diese Feststellung beinhaltet nicht, Kritikwürdiges nicht zu kritisieren (wie auch die alte Sowjetunion und die Staaten des damaligen Ostblocks nicht von Kritik ausgenommen waren, auch nicht in der Entspannungsperiode). Der Entspannungsappell richtete und richtet sich immer an potentielle Gegner, nicht an befreundete Staaten und zielt darauf, den Status quo positiv zu verändern, nicht: ihn zu verfestigen. (Im Übrigen ist es ein Gebot der Glaubwürdigkeit, wenn man die Aktionen der Großmächte unserer Zeit, etwa im Hinblick auf Verletzungen des Völkerrechts, nicht mit zweierlei Maß misst.) Dankbarkeit schlägt in der Politik nur selten zu Buche, aber wir Deutschen sollten jedenfalls nicht vergessen, was wir der sowjetischen Führung von 1989/90 und namentlich Michail Gorbatschow verdanken.
Bisher war eher von den äußeren Bedingungen der deutschen Einigung die Rede. Entscheidend war indessen letztlich die innere Entwicklung in der DDR. Erinnern wir uns: Im Frühjahr 1989 beging die Bundesrepublik den 40. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes und damit der westdeutschen Staatsgründung. Kein Politiker von Gewicht hielt die Wiedervereinigung für ein realistisches Ziel der operativen Politik, und das gilt ebenso für die veröffentlichte Meinung und für die Masse der Bevölkerung. Zu denen, die verstanden hatten, was die Stunde schlug: dass die Verhältnisse im östlichen Europa, auch in der DDR, in Bewegung gerieten, gehörte Erhard Eppler, der am 17. Juni 1989 im Bundestag eine allseits beklatschte Rede hielt. Doch wirklich rezipiert wurde Epplers realistische Analyse nicht. Die wenigen Intellektuellen links und rechts der Mitte, die ansonsten vor Herbst 1989 auf die sich erkennbar verändernden Verhältnisse hinwiesen, galten als Illusionisten und Störenfriede: entweder der NATO-Loyalität oder des Friedens oder der inneren Stabilität der Bundesrepublik. Schließlich kam die Einheit, auch aufgrund des zupackenden Handelns der damaligen Bundesregierung, auf eine Art und Weise und in Formen zustande, die noch Mitte 1989 unwahrscheinlich schienen und es auch waren; deshalb haben selbst die langjährigen Mahner und Vordenker nur insofern Recht behalten, als sie gewissermaßen die Einäugigen unter den Blinden gewesen sind.
Die Dynamik der meist als ›friedliche Revolution‹ bezeichneten revolutionär-demokratischen Volksbewegung in der DDR begann mit der Fluchtwelle des Sommers. Den zweiten Anstoß gaben die, häufig unter dem schützenden Dach der Evangelischen Kirche, schon länger existierenden Bürgerrechts-, Umwelt- und Friedensgruppen einschließlich einer neu gegründeten Sozialdemokratischen Partei, die im Lauf des Jahres 1989 ihre Isolation durchbrechen konnten und alle ab Anfang September die Anerkennung ihrer legalen Existenz einforderten. Wenn man die Programme und Positionspapiere dieser Gruppierungen nachliest, dann wird offensichtlich, dass sie zwar nicht gegen die deutsche Einigung waren, wie man bisweilen hören kann; doch das Schwergewicht legten sie auf die innere Demokratisierung der DDR; sie wollten das juristische Volkseigentum an den Produktionsmitteln nicht abschaffen, sondern gesellschaftlich in Besitz nehmen. Unabhängig davon, ob das, zumal unter den obwaltenden Umständen, eine realistische Zielsetzung war, gebietet es die Wahrhaftigkeit, es nicht zu verschweigen – und auch nicht den dritten Faktor der Umwälzung: die Machtverschiebung in der SED – von Honecker und Stoph über Krenz zu Gysi und Modrow – im Zuge einer wachsenden Auflehnung der Parteibasis gegen ihre Oberen, wenngleich zu spät, um das Geschehen noch steuern zu können. Im Zuge der rasanten Auflösung der DDR als Staat seit der Maueröffnung – von den Betreibern eigentlich gedacht, um Dampf aus dem Kessel zu lassen – besann sich die SED/PDS auf die gesamtdeutsch getönten Appelle und Konföderationsvorschläge der Ära Ulbricht, doch nachdem die Partei in Reaktion auf die Neue Ostpolitik der Regierung Brandt 1970 von der Zwei-Staaten- zur Zwei-Nationen-Doktrin mit der strikten Abgrenzung zur Bundesrepublik übergegangen war und diese Linie fast zwei Jahrzehnte beibehalten hatte, wirkte die erneuerte Parole ›Deutschland - einig Vaterland‹ – eine Verszeile aus der DDR-Hymne, aber seit Langem nur noch in der Instrumentalversion benutzt – wenig glaubwürdig.
Wie groß der politische, auch der wirtschaftspolitische Spielraum im Zuge des Annäherungs- und Vereinigungsprozesses war, wird bis heute unterschiedlich und gegensätzlich diskutiert. Alternativlosigkeit ist keine gute Parole für Politik in der Demokratie. Aber natürlich ist nicht immer alles bei diesen oder jenen Wünschenswerte machbar. Heute bejahen nach einer aktuellen Umfrage 95 Prozent der Deutschen die staatliche Einheit, und auch Kritiker des Bestehenden stellen diese nicht infrage. Zugleich fühlt sich die Mehrzahl der Ostdeutschen bis heute nicht als gleichrangige deutsche Staatsbürger, ohne die Errungenschaften der vergangenen drei Jahrzehnte zu übersehen. Harte materielle Fakten wie die radikal unterschiedliche Vermögens- (mehr noch als die Einkommens-)Lage und die weiterhin überwiegende Besetzung von Führungspositionen in den östlichen Bundesländern mit Westdeutschen machen deutlich, dass das Unterlegenheitsgefühl kein Hirngespinst ist. Ein beträchtlicher Teil des Unmuts, den wir verstärkt im Osten finden – er wurde etliche Zeit von der PDS bzw. Linkspartei ausgedrückt und schlägt wie anderswo in Europa inzwischen hauptsächlich nach Rechtsaußen aus – ein Teil dieses fehlgeleiteten sozialen Protests geht auf die übertriebenen Erwartungen zurück, mit denen die – ökonomisch höchst problematische – Währungsangleichung und der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 1990 begleitet wurden. Die damit verbundenen Illusionen sind von westdeutschen Politikern damals eher gefördert als gedämpft worden.
Und ebenso darf man kritisieren, dass die Wieder- oder Neuvereinigung westlicherseits in der Regel auf die Entscheidung der Ostdeutschen reduziert, ob sie sich anschließen wollen oder nicht, nicht jedoch als ein gemeinsames Projekt von historischen Dimensionen gesehen wurde, wo alles auf den Prüfstand gehörte. Das war der Hintergrund der Diskussion über die Anwendung des damaligen Artikels 23 GG (die Beitrittslösung) oder des Artikels 146 (Wahl einer souveränen gesamtdeutschen Nationalversammlung). Man hätte übrigens auch beides kombinieren können und könnte es immer noch. Wie auch immer: Schon die erste freie DDR-Volkskammerwahl vom 18. März 1990 mit dem Wahlsieg der CDU-geführten ›Allianz für Deutschland‹ entschied faktisch über den weiteren Weg. Und an der Entscheidung der Mehrheit ist nicht zu deuteln.
Trotzdem liegt mir daran zu unterstreichen, dass die kritische Auseinandersetzung mit dem Einigungsprozess, so wie er verlief und verläuft, keine Miesmacherei ist. Patriotismus bedeutet Wertschätzung des eigenen Landes und Volkes (verstanden als die Gemeinschaft deutscher Staatsbürger), nicht die Hinnahme der gesellschaftlichen Zustände, wie sie sind, oder gar deren Verherrlichung. Als sich der Begriff Patriot/Patriotismus in der Aufklärungsära des 18. Jahrhunderts durchsetzte, war er untrennbar verbunden mit der tätigen Verbesserung des Bestehenden. Diejenigen, die im 19. Jahrhundert für die Freiheit und Einheit Deutschlands kämpften, die nach dem Sturz der Monarchie 1918 – unter weitaus schwierigeren Bedingungen als ab 1949 – die erste deutsche Demokratie zu sichern und zu gestalten suchten, und nicht zuletzt die Männer und Frauen im antihitlerischen Widerstand, der sich in allen seinen unterschiedlichen Teilen als das andere und bessere Deutschland – mit Betonung auch auf dem Hauptwort – verstanden, waren von echter, wohlverstandener Vaterlandsliebe geleitet. Für diejenigen unter ihnen, die sich zugleich als Weltbürger oder Internationalisten begriffen, stand beides nicht im Widerspruch zueinander. Eine solche Einstellung unterschied und unterscheidet sich grundlegend von den Exzessen des Nationalismus und Imperialismus, die – mit dem totalitären Faschismus und Nationalsozialismus als grauenvollem Höhepunkt – die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten.
Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass die Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Union gehört. Entgegen dem, was man häufig hören und lesen kann, bin ich der Auffassung, dass Europa und seine nationalen Glieder grundsätzlich gut harmonieren können. Das gilt ohnehin für die Nationen als Kultur- und Kommunikations-, Bewusstseins- und Gefühlsgemeinschaften; diese werden unter dem europäischen Dach in sich verändernder Zusammensetzung weiter existieren. Es gilt darüber hinaus für absehbare Zeit auch für die Nationalstaaten, die noch gebraucht werden. Sie sind schon heute keine absolut souveränen Staaten des alten Typs mehr, und das ist gut. Denn für sich allein können die Nationalstaaten das europäische Zivilisationsmodell, zu dem auch die Sozialstaatlichkeit gehört, nicht verteidigen und weiterentwickeln, noch werden sie imstande sein, die vor uns stehenden, großen globalen Aufgaben erfolgreich in Angriff zu nehmen. Ohne krampfhaft nach einer Balance zu suchen, können wir heute sehr bewusst Deutsche, Europäer und Weltbürger gleichzeitig sein. Der dritte Bundespräsident Gustav Heinemann formulierte bei seiner Amtsübernahme am 1. Juli 1969: »Es gibt schwierige Vaterländer. Eines davon ist Deutschland« – hier spielt Heinemann natürlich auf den NS-Komplex an, 24 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – »Aber es ist unser Vaterland. Hier leben und arbeiten wir. Darum wollen wir unseren Beitrag für die eine Menschheit mit diesem und durch dieses unser Land leisten.«
(Ansprache von Prof. Dr. Peter Brandt am 3. Oktober 2019 in Backnang)