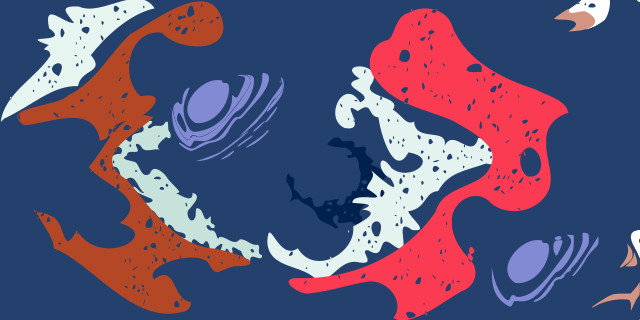von Herbert Ammon
I.
Aus bekannten Gründen gibt sich innerhalb des westlichen Teils der EU kaum ein Land soviel Mühe mit Begriff und Inhalt von ›Integration‹ wie die übergrünte Bundesrepublik. Wie kommt man in Deutschland (›in diesem unserem Land‹), 30 Jahre post murum erkennbar west-östlich geschieden und von Tag zu Tag ›diverser‹ und/oder ›bunter‹, zu einer Art alle real existierenden Unterschiede (de facto Spaltungen) überwölbenden Gemeinschaftsgefühl oder – weniger gefühlvoll – zu einem politischen Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, kurz: zu dem, was man früher ›Patriotismus‹ oder auch Nationalbewusstsein nannte? Was hält das Land oder die in der EU aufgehobene, im Vertrag von Lissabon (2007/2009) als Begriff immerhin noch explizit bestätigte ›Nation‹ außer dem – von vielerlei ungewissen Faktoren abhängigen – Wohlstand zusammen? Im Kern geht es um die Fundierung – oder Überhöhung – des Gemeinwesens durch eine säkulare Zivilreligion.
Seit dem von Napoleon Bonaparte erzwungenen Untergang des Alten Reiches tun sich die Deutschen schwer mit der Definition ihrer ›Nation‹. Nach der Bismarckschen Reichsgründung diente der kulturprotestantisch geprägten deutschen Geisteswelt die Unterscheidung von Staats- und Kulturnation der Beschwichtigung letztendlicher Zweifel an der Weisheit der Geschichte und der ›kleindeutschen Lösung‹ der deutschen Frage. Das Anschlussverbot im Versailler Vertrag sowie im Vertrag von Saint-Germain erweckte erneut großdeutsche Emotionen und Hoffnungen quer durch die Lager von rechts bis links. Dieser Traum war 1945 ausgeträumt.
Im geteilten Deutschland der Nachkriegszeit erlebte die Unterscheidung Kulturnation-Staatsnation eine Renaissance. Anno 1970, als sich der Großteil der 68er-Generation von der politischen Realität im allgemeinen, von der Realität des geteilten Landes im besonderen, verabschiedet hatte, während Willy Brandt und Egon Bahr mit der ›neuen Ostpolitik‹ die Nation im Zustand der Teilung zu bewahren suchten, veröffentlichte Dolf Sternberger seinen Aufsatz zum ›Verfassungspatriotismus‹. Anders als in den 1980er Jahren, als Jürgen Habermas einen post-national und ›universalistisch‹ zu definierenden Verfassungspatriotismus propagierte (und dies mit dem spezifisch deutschen Argument der verfehlten Nationalgeschichte), gehörte für Sternberger das im Grundgesetz verankerte patriotische Ziel der deutschen Einheit noch zu den Elementen des Begriffs.
Mit dem unerwarteten Mauerfall und der Wiedervereinigung – durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik über Artikel 23 GG – schien sich die Debatte über die ›richtigen‹ Begriffe von Nation und Verfassung erübrigt zu haben. Sie kehrte alsbald wieder im Gefolge der durch anhaltende Einwanderung, migrantische Parallelgesellschaften und Subkulturen, neue Staatsbürgerschaftsgesetze, ›Multikultur‹, Fremdenfeindlichkeit, west-östliche Befremdung, Neonazismus und Antifa grundlegend veränderten politischen Szenerie im vereinten Deutschland. Die vermeintlich bewältigte ›Flüchtlingskrise‹ von 2015, der kaum verminderte Zustrom – nach wie vor 15 000 pro Monat – von Migranten aller Art, die durch das jüngste ›Fachkräftegesetz‹ bekräftigte Definition der Bundesrepublik als Einwanderungsland, last but not least der Auftritt der AfD, nötigen zu Reflexionen über die kulturell-soziale Wirklichkeit und über die für ›Integration‹ erforderlichen ideellen – oder wertfrei betrachtet: ideologischen – Voraussetzungen des deutschen Staatsgebildes.
II.
Was immer die Zukunft der deutschen Gesellschaft im 21. Jahrhundert sein mag – politische, demographische, ethnisch-soziale und ethnisch-kulturelle Risse sind nicht zu übersehen. Als in den Medien groß aufbereitetes Beispiel sei die Liebe des Fußballstars Mesut Özil zu ›seinem‹ Präsidenten Erdogan erwähnt. Im Hinblick auf derlei Realitäten meinte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans mit dem Plädoyer für die »Bekenntnisnation« (T. H. ,»Deutsch – eine Frage des Bekenntnisses«, in: FAZ v. 6. Juni 2019) einen eigenständigen, für die politische Praxis ›zielführenden‹ Beitrag zu leisten. Der zuerst von dem aus Syrien stammenden liberalen Muslimen Bassam Tibi eingeführte, sodann von Friedrich Merz propagierte – und unverzüglich von linksliberalem Entsetzen begleitete – Begriff ›Leitkultur‹ kommt darin nicht vor. Selbst gegen die ›Kulturnation‹ wendet sich der Autor, da dieser Begriff den emotionalen ›Anschluss‹-Gedanken bezüglich Österreichs und/oder Elsass-Lothringens befördern könne. Stattdessen proklamiert der Saarländer Hans die ›Bekenntnisnation‹.
Der Würzburger Historiker Peter Hoeres hat diese Vorstellung eines gut gemeinten Begriffs abgewiesen, indem er klarstellt, dass es sich um nichts anderes als die Wiederauflage des Habermasschen post-nationalen ›Verfassungspatriotismus‹ handele (»Kultur und Nation« in: FAZ v. 19.06.2019, https://edition.faz.net/faz-edition/politik/2019-06-19/117a13038dad021c01853495f4027919/?GEPC=s9&fbclid=IwAR1XBCDoU450CLVw49alSq_UapXMA_x4NNfYSFfWyaZEXoiv1JUgfy8Pces). In anderen Worten: Der saarländische Verkünder der ›Bekenntnisnation‹ gießt lediglich alten Wein in neue Schläuche. Hoeres korrigiert auch Hans' Verknüpfung seiner ›Bekenntnisnation‹ mit der vermeintlich von Ernest Renan antithetisch zur ›Kulturnation‹ proklamierten ›Willensnation‹.
Seit langem erscheint in deutschen Diskursen, wo es um Abwehr der ›Kulturnation‹ (oder der ›Leitkultur‹) und das vermeintlich republikanisch unzweifelhafte Bekenntnis zur Staatsnation als ›Willensnation‹ geht, das Zitat aus Renans Rede vor der Sorbonne (1882) von der Nation als eines täglichen Plebiszits (»une plébiscite de tous es jours«) stets nur als aus dem Zusammenhang gerissenes Schlagwort. In Wirklichkeit geht es bei Renan um den in erlebter Geschichte und Erinnerung begründeten emotionalen Charakter der Nation, der diese in der Gegenwart zu politischem Handeln für die Zukunft befähige: ›Eine Nation ist eine Seele, ein geistiges Prinzip (une âme, un principe spirituel)‹. Gegenüber dem in deutschen Politikseminaren vorherrschenden Missverständnis erläutert Hoeres Renans Konzept wie folgt: ›Dabei wird verkannt, dass die französische Willensnation durchaus mit der französischen Kultur und Sprache – wo wird diese mehr als schützenswerte Essenz der Nation verstanden als in Frankreich? – verknüpft ist und auch das französische Staatsbürgerrecht ein ergänztes Ius sanguinis ist.‹
Im Blick auf den aktuellen Zustand der EU und die in allen Parteien – außer der ›populistischen‹ AfD – propagierte Forderung nach ›mehr Europa‹ sei ein weiteres Zitat aus der Rede Renans hinzugefügt: ›Die Übereinstimmung der Interessen ist sicherlich ein starkes Band zwischen den Menschen. Doch reichen die Interessen aus, um eine Nation zu bilden? Ich glaube es nicht. Die Interessengemeinschaft schließt Handelsverträge ab. Die Nationalität jedoch hat eine Gefühlsseite, sie ist Seele und Körper zugleich. Ein ›Zollverein‹ kann kein Vaterland sein.‹
III.
Der Historiker Renan wusste um die Vergänglichkeit von Staaten, Kulturen und Nationen. ›Die Nationen sind nichts Ewiges. Sie haben einmal angefangen, sie werden enden. Die europäische Konföderation wird sie wahrscheinlich ablösen (La confédération européenne, probablement, les remplacera).‹
Man mag die EU, derzeit noch ein Zwischending zwischen Staatenbund und Bundesstaat, als Erfüllung dieser – von Renan unter dem ›Gesetz des (19.) Jahrhunderts‹ noch für unrealistisch erachteten – Vision interpretieren. Die Zukunft der EU und der darin vereinten Nationalstaaten ist indes – nicht nur angesichts des drohenden Brexit – ungewiss. In ihrer im Gefolge von Maastricht (1992) in diversen Verträgen fixierten Verfassung hat sie das Konzept einer Konföderation bereits hinter sich gelassen. In ihrer constitution réelle ist sie indes vom Ziel eines alle Europäer umfassenden Verfassungspatriotismus noch weit entfernt. Dies gilt nicht nur für die separatistischen Tendenzen in Spanien, für den als ›anti-europäisch‹ perhorreszierten Eigensinn der Ungarn und Polen und für das Gespenst des ›rechten‹ Nationalismus und/oder Populismus.
Das tiefere, mit der Parole ›bunt statt braun‹ übertünchte Problem der staatsbürgerlichen Loyalität, des immer wieder beschworenen ›Verfassungspatriotismus‹, liegt in der durch Einwanderung entstandenen kulturell-sozialen Heterogenität der westeuropäischen Gesellschaften. Wie eine alle Bevölkerungsgruppen einende Gefühlsbindung an die ›Nation‹ – oder an ›Europa‹ – zu bewerkstelligen sei, daran bestehen mittlerweile selbst im laizistisch-republikanischen Frankreich wachsende Zweifel. Man wird sehen, ob dem von Präsident Macron proklamierten Konzept eines mehrwöchigen Sozialdienstes für alle Jugendlichen – als einer Art ›Schule der Nation‹ und als Ersatz für die 1997 abgeschaffte Wehrpflicht – zur Erweckung republikanischen Gemeinsinns Erfolg beschieden sein wird.
Erst recht gilt diese kritische Feststellung für Deutschland mit seiner spezifischen Nationalgeschichte. Wer meint, mit der Beschwörung von ›Verfassungspatriotismus‹, der Verpflichtung auf die vermeintlich universalen Werte im Grundgesetz – wer kümmert sich in den aktuellen Debatten noch um die verfassungsgemäße Unterscheidung von Menschenrechten und staatsbürgerlichen Rechten? – sowie mit der kontinuierlichen Vergegenwärtigung der NS-Verbrechen eine krisenbeständige Grundlage der res publica schaffen zu können, befindet sich auf dem Holzweg. Einigen Protagonisten des ›Verfassungspatriotismus‹ ist die Schwäche ihres Arguments angesichts der Realität womöglich sogar bewusst.