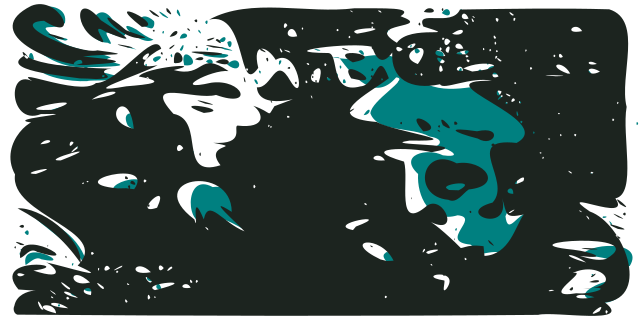von Herbert Ammon
I.
Hätte Kevin Kühnert nicht aus jungsozialistischer Überzeugung die Eigentumsfrage gestellt, den Kapitalismus als solchen als Grundübel der Gesellschaft benannt, der 1. Mai 2019 wäre ohne jegliche Aufregung verlaufen. Gegenüber Kühnerts Proklamationen verloren die Berliner Traditionsveranstaltungen – Klassenkämpfe im Teilbezirk Friedrichshain mit nur etwa 35 verletzten Polizisten, dazu ein fröhlicher Marsch auf die bourgeoise Hochburg Grunewald – an medialem Stellenwert.
Nun aber hat der noch recht juvenil aussehende Juso – angetan mit Kapuzenpulli überm schwarzen Leiberl mit revolutionärem Stern und/oder mit EU-Sternenkranz – Partei und Land in Erregung versetzt. Klassenkampfparolen, Kritik am menschenfeindlichen Kapitalismus hatte man über Jahre allenfalls am äußeren Rand, von der das Begriffsmonopol beanspruchenden Partei ›Die Linke‹ vernommen. Und nun plötzlich so etwas aus dem Munde eines jungen Mannes aus einer – mutmaßlich mittelbürgerlichen – (West-)Berliner Beamtenfamilie mit Eigenheim in Lichtenrade!
Wie weit Kevin Kühnert bei seinen unvollendeten Studien der Kommunikations- und Politikwissenschaften mit marxistischer oder sonstiger Theorie die Mechanismen des Kapitalismus – das tiefere Problem, Sozialismus hin oder her, liegt in der Wertschöpfung, nicht primär in der Aneignung, in den Marktmechanismen und erst dann in der Verteilung der Gewinne – durchdrungen hat, ist kaum zu klären. Das ist auch gar nicht nötig. Denn für Talkshow-Debatten oder Parteitagsreden, für demokratisches leadership, ist in erster Linie rhetorisches Talent gefragt, nicht analytischer Sachverstand. Und an Redekunst fehlt es dem Juso-Chef keineswegs. Wenn er den Neoliberalismus attackiert – für Kritik gäbe es plausible Gründe, sofern man nicht die Mühe scheut, eine zutreffende Definition zu liefern –, verfügt er sogar über ein differenzierteres Vokabular als seine Parteivorsitzende, die Literaturwissenschaftlerin Andrea Nahles (›Ätschi, bätschi!‹). Wie er indes den globalisierten Markt, genauer: die Märkte, insbesondere die Finanzströme, ›sozial gerecht‹ verändern und lenken könnte, weiß der Jungsozialist mit Sicherheit so wenig wie die durchschnittliche grüne Pastorin/der Pastor in ihrer/seiner Sonntagspredigt.
II.
In der Politik, schon gar nicht in der Parteipolitik, kommt es auf Expertise weniger an denn auf Erfolg im Streben nach und/oder im Umgang mit Macht. So geht es auch unserem jungen Jusochef (29 Jahre), qua Funktion bereits Mitglied im Parteivorstand, höchstwahrscheinlich um seine weitere Parteikarriere, nicht um die von rasant steigenden Mieten in den Großstädten bedrohten Durchschnittsverdiener der unteren Mittelschicht oder um die Kapuzenpullis nähenden Kinder in Bangladesch.
Kühnerts radikale Reden passen seiner Parteiführung derzeit nicht ins Konzept. Sie gefährden die ohnehin bescheidenen Erwartungen der SPD (realistisch >15 Prozent, Maximalerwartung 20 Prozent) bei den anstehenden Europawahlen. Entsprechend wird es noch eine Weile dauern, bis der ehedem sakrosankte, seit der Ära Schröder – auch Gerhard Schröder fing mal als Juso-Bürgerschreck an – außer Kurs gesetzte Begriff des ›demokratischen Sozialismus‹ wieder in einem Parteiprogramm Verwendung findet. Vorerst lehnt die Parteiführung – mit Ausnahme des ›linken‹ Parteimannes Ralph Stegner – die von Kühnert proklamierte Rückwendung zum irgendwann in den 1990er Jahren abgelegten Begriffsarsenal ab.
Zwar theoretisiert man hie und da seit dem in der Finanzkrise 2008ff. drohenden – vermittels immenser Geldschöpfung, Kreditausweitung ad libitum sowie Nullzinspolitik der EZB abgewendeten – Zusammenbruch des westlichen Geldmarktes über Alternativen zum ungezügelten Wirtschaftsliberalismus, aber zu sozialistischen Konzepten wollen sich die – auch in der einstigen Arbeiterpartei SPD allenthalben tonangebenden – Kulturlinken lieber nicht bekennen. Genderfragen und -grammatik, Planstellen im Bologna-System sowie in der Sozial- und Kulturindustrie sind ihnen wichtiger als anstrengende Kapitalismusanalysen. Vielleicht haben sie begriffen, dass Auseinandersetzungen mit der dismal science der politischen Ökonomie den Zustand der Welt kaum noch verändern könnten. Im übrigen lebt die Kaviar- bzw. Kulturlinke von den kapitalistisch erzeugten und/oder staatlich verteilten Steuern und Stiftungsmitteln recht zufrieden. Radikale Rhetorik gehört zu den beruflichen Voraussetzungen im ideologischen Überbau.
III.
Wenn jetzt der fast 78jährige Bernie Sanders in den USA noch einmal als Präsidentschaftskandidat auf die Bühne tritt und ›demokratischen Sozialismus‹ als Programm proklamiert, steht ihm nicht viel anderes als der in Staaten wie der Bundesrepublik – mit etatistisch deutscher Vorgeschichte – in langen Perioden von Wirtschaftswachstum und Wohlstand etablierte Sozialstaat vor Augen. (Wie schwierig der Umbau des amerikanischen Sozialsystems zu gestalten ist, zeigen indes die Auseinandersetzungen um die unvollendete ›Obamacare‹ im Gesundheitswesen.)
Womöglich passt der Begriff ›demokratischer Sozialismus‹ nicht mehr zur weltpolitischen Realität des 21. Jahrhunderts. Mit Ausnahme von Kuba, Bolivien, Venezuela sowie vielleicht noch Nicaragua unter der Kleptokratie des Ortega-Clans gibt es kaum ein Land auf der Erde mehr, das sich zum Sozialismus bekennt. Unklar ist, ob der Begriff im einstigen Apartheid-Staat Südafrika noch zur Praxis werden könnte. Die Weltmacht China exemplifiziert das realhistorische Paradoxon auf einzigartige Weise: Alle Macht liegt in den Händen der – nach ideologischem Belieben mit Marx, Mao und Historie operierenden – kommunistischen Partei, genauer: der Parteiführung unter dem Präsidenten Xi Yinping. Die derzeit mit minderen Wachstumsraten expandierende Wirtschaft basiert auf radikalem Marktkapitalismus unter staatlicher Protektion. Über das realpolitisch schwer zu taxierende Verhältnis von weltweitem ökonomischem Nutzen und geopolitischen Zielen der Han-Chinesen streiten sich die westlichen Thinktanks. Inwieweit sich die deutschen Grünen um die ökologischen Folgen der – in Gestalt von Häfen, Kanälen, Eisenbahnen, Flughäfen, Straßen, Industrieanlagen aller Art – in globalem Maßstab vorangetriebenen chinesischen Glücksverheißungen Sorgen machen, kann als Frage offen bleiben. Macht- und/oder Geopolitik ist ein in grünen ›Diskursen‹ ohnehin nicht vorhandener Begriff.
IV.
Welchen theoretischen Sinn, welche analytische Qualität und welche wirtschaftspolitische Praktikabilität ist demnach dem ›linken‹ Begriff ›demokratischer Sozialismus‹ noch zuzumessen? Aus dem französischen Frühsozialismus stammt die Definition des ›Sozialismus‹ als ›einer höheren Form von Gesellschaft‹, ein Synonym für eine gemäßigte oder radikale Utopie. Deren Realisierung versuchten die meisten Utopisten, einschließlich der Saint-Simonisten, in allerlei perfektionistischen Gemeinschaftsprojekten. Nur Graf Henri de Saint-Simon (1760-1825) selbst, fortschrittsgläubiger Erfinder der Bienen-Parabel und sonstiger sozialistischer Kerndoktrinen (›Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen‹) dachte auch an einen staatlichen Ordnungsrahmen in dem von ihm proklamierten neuchristlichen Zeitalter.
Historisch war das Ideengut des Sozialismus im Ursprung – in Deutschland im Vormärz – mit der über den Liberalismus hinausweisenden ›Demokratie‹ verknüpft. Mit den preußischen ›Kathedersozialisten‹ erfuhr der Sozialismus eine Wendung zum nationalen Wohlfahrtsstaat, der auf eine demokratische Theorie auch verzichten konnte. Der preußische Sozialismus in Gestalt der von Walter Rathenau organisierten Kriegswirtschaft inspirierte Lenins Konzept staatssozialistisch gelenkter Wirtschaft. Auseinandersetzungen über den von manchen ›Rechten‹ und Liberalen behaupteten ›linken‹ Charakter des Nationalsozialismus verdeutlichen, dass ›Sozialismus‹ keineswegs nur eine unbescholtene Idee war oder ist.
Will man sodann den ›demokratischen Sozialismus‹ nicht als Relikt des vergangenen ›sozialdemokratischen Jahrhunderts‹ abtun, so geht es um Reflexionen über Attribut und Nomen, über die Beziehungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat in der res publica unter den Bedingungen der ›Globalisierung‹. Sieht man ab von anarchistisch-utopischen Idealvorstellungen sowie von der jüngsten, pseudomoralischen ›no borders‹-Ideologie, geht es erstens um die ›demokratisch‹, ›sozial‹ und ›sozial gerecht‹ geregelten Verhältnisse innerhalb eines Staates und zweitens um sinnvolle Arbeitsteilung und politisch-wirtschaftliche Beziehungen von Ländern und Staaten.
Was den letzteren Bereich betrifft, so erscheint der internationale Freihandel – eine liberale, keine sozialistische Doktrin – als das global fruchtbringende Konzept. In der weltpolitischen Realität wird es von US-Präsident Trump, vom – meist herabgespielten – Protektionismus der EU, von wirtschaftlichen Sanktionen gegen Putin und den Iran sowie von den Praktiken der OPEC-Länder in Frage gestellt. Machtpolitik dominiert nach wie vor über die liberale Utopie des Weltfriedens durch den global freien Markt. Zur Ironie der Weltpolitik gehört derzeit die Unterstützung von Ländern wie Venezuela und Kuba durch post-sozialistische Länder wie Russland und China in Fortsetzung aus dem Kalten Krieg bekannter Machtstrategien.
Sozialistische Kritik, d.h im älteren Sinne ›linke‹ ökonomische Theorie, zielt auf das in den 1970er (Ära Thatcher) und 1980er (Ära Reagan) Jahren gegen keynesianische Doktrin und Praxis durchgesetzte Konzept des Neoliberalismus. Zur theoretischen Leitlinie in Universität, Wirtschaft und Politik wurde unter dem Einfluss der Chicago-Schule die Neoklassik, das Konzept des sich selbstregulierenden Marktes. Die neoliberale Doktrin ging einher mit technischen Innovationsschüben (›digitale Revolution‹), die parallel zum verschärften Wettrüsten 1979ff. den weltpolitischen Siegeszug des ›Westens‹ über die ökonomisch-technisch zurückgebliebene Sowjetunion einleiteten und den Zerfall ihres Imperiums mit sich brachten.
V.
Natürlich war diese Entwicklung nicht zwangsläufig. Ein nicht unwesentlicher historischer Zufallsfaktor war anno 1984 der Tod des erfahrenen Machtpolitikers Juri Andropow, der wiederum Michail Gorbatschow als Ziehsohn erkoren hatte. Der Zusammenbruch der Sowjetunion mündete in der Ära Jelzin in eine von liberal-kapitalistischer Doktrin – bekannt als ›Schocktherapie‹ von Ex-Kommunisten wie Jegor Gaidar – inspirierte ungeordnete Privatisierung aller staatlich kollektivierten Besitzstände. Das führte in den meisten Nachfolgestaaten des Imperiums – anders als in den politisch-kulturell disziplinierteren baltischen Staaten – zu anomischen Zuständen: Aufstieg der ›Oligarchen‹, Bereicherung der ›neuen Russen‹, Korruption, Verbrechen, und Verelendung breiter Volksschichten. Erst in der Ära Putin wurden in Russland diese Zustände durch ein autoritäres Regime und durch Verstaatlichung des devisenbringenden – und für politische Pressionen gegen die Ukraine geeigneten – Energiesektors (Rosneft, Gasprom etc.) überwunden. In der wirtschaftlichen Gesamtleistung (BIP) liegt die Russische Föderation – trotz bemerkenswerter Wachstumsraten – weltweit (mit den USA und der EU mit rund 19 Billionen US-Dollar an der Spitze, gefolgt von China mit 5,5 Billionen US-Dollar) hinter Ländern wie Kanada und Südkorea mit 1,5 Billionen US-Dollar erst an zwölfter Stelle. (Zahlen von 2017; https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt)
In China erkannte der ›Reformer‹ Deng Xiaoping die Vorzüge des kapitalistisch-liberalen Systems und bereitete den Weg für den spektakulären Aufstieg des ›Reichs der Mitte‹ zur Weltmacht. Aus dem Land der ›blauen Ameisen‹ wurde ein kapitalstarkes Land mit produktiver Landwirtschaft, leistungsfähigen, exportorientierten Großkonzernen samt einer im Zeichen hoher Wachstumsraten prosperierenden Mittelschicht. Nicht anders gelang dem ungeliebten südlichen Nachbarland Vietnam seit den 1990er Jahren ein bemerkenswerter Aufstieg. Mit ›linkem‹ Schamgefühl könnte man auch Chile als neoliberales Erfolgsmodell erwähnen. Letztlich profitieren sogar auf der OECD-Skala weit unten angesiedelte Länder wie Bangladesch dank ihrer Billiglöhne vom neoliberalen Weltsystem.
Die neoliberale Praxis in den USA wurde in den 1990er Jahren in der Ära Clinton – politisch-strategisch parallel zur Osterweiterung der NATO – fortgesetzt. Es gilt daran zu erinnern, dass in jenen Jahren um einheimische Arbeitsplätze besorgte Stimmen – in Kanada etwa die linkssozialdemokratische Neue Demokratische Partei (NDP) – gegen das umfassende nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA opponierten. Tatsächlich bewirkte NAFTA hohen Kapitalexport ins Niedriglohnland Mexiko, wo der Ausbau von Industrien und die intensivere Teilnahme am US- und Weltmarkt für größere Bevölkerungsgruppen mehr – bescheidenen – Wohlstand ermöglichte. In den USA hingegen beschleunigte der Freihandel den Niedergang der veralteten Industrien im rust belt. Zu den Ironien der Geschichte gehört, dass ein Donald Trump gegen den Willen des liberalen Partei-Establishments der Republikaner mit einem gegen China und die EU gerichteten, protektionistischen, ›populistischen‹ – oder, wenn man so will, eben auch ›linken‹ – Wahlversprechen an die Verlierer der Globalisierung ins Amt gelangt ist.
Wie international ›gerechte‹ Austauschprozesse (fair trade) zu realisieren sind, steht als ungelöste Frage im Raum. Während einige den OECD-Kriterien entsprechend als ›Schwellenländer‹ (developping countries) kategorisierte Länder wie Vietnam oder Ruanda bemerkenswerte Wachstums- und Wohlstandsgewinne verzeichnen, kommen zahllose andere nicht aus ihrer Misere heraus. Neben offenbar unheilbarer Korruption verhindert insbesondere in Afrika das immense Bevölkerungswachstum eine einst in der Entkolonialisierungsphase des letzten Jahrhunderts erhoffte positive Entwicklung (z.B. Walt Rostows take-off into self-sustained growth – ›Aufstieg in selbsttragendes Wachstum‹). Wohlgemeinte Konzepte von ›Entwicklungshilfe‹ scheitern seit langem vielerorts an der Realität. Es gibt hoffnungsvolle Ausnahmen wie Kenia, zuletzt offenbar auch das auf über 100 Millionen angewachsene Äthiopien.
Kulturelle Faktoren – Religionen, Traditionen, Stammesloyalitäten, archaische Verfeindungen – sind entgegen den Erwartungen und Proklamationen der ehedem meist als Sozialisten auftretenden Führer der antikolonialen Befreiungsbewegungen und ihrer westlichen Unterstützer keineswegs von einem kollektiv aufgeklärten – letztlich ›westlichen‹ Fortschrittsdenken abgelöst worden, sondern manifestieren sich in failing states, Kleptokratien, Diktaturen, Clanloyalitäten und ethnischen Konflikten. Dass in vielen Regionen unter entsetzlichen Arbeitsbedingungen Rohstoffe für die Bedürfnisse – obenan digitale Kommunikation und Lenkungssysteme – der nördlichen Wohlstandsregionen produziert werden, gehört zu den unerfreulichen Fakten, ist von den skizzierten Bedingungen aber nicht zu trennen. (Siehe dazu auch https://derstandard.at/2000102430552/Tesla-warnt-Rohstoffe-fuer-Batterien-werden-knapp?fbclid=IwAR2Klm16wVEsn6oE1eKOPjc47iBmDroa_XMgpHmiziXlpt9ycOCikn5bAeQ)
VI.
Mit der Globalisierung – längere Wertschöpfungsketten, enorm wachsender Energiebedarf, Produktionssteigerungen in allen Sektoren, maßgeblich im IT-Bereich, beschleunigter Welthandel – gingen die Veränderungen des internationalen Finanzsystems einher. Bereits vor der Finanzkrise 2007ff. kam es in den USA und in Europa zu massiver Geldschöpfung, Niedrigzinsen und Kreditausweitung, was wiederum sowohl im Finanzsektor (obenan Investment-Banking) sowie auf der Ebene des Managements der Großkonzerne die Anhäufung von immensen Vermögen ermöglichte. Die offenbar unbegrenzte Geldschöpfung – nicht zuletzt seitens der EZB zur Abwehr von Staatspleiten – führte zur klassischen Diskrepanz von Geldvolumen und realer – nach wie vor im industriell-technischen Sektor zentrierter – Wertschöpfung. Zugleich zu der in westlichen Wohlfahrtsstaaten jahrzehntelang vermiedenen Vermögensspreizung: ›oben‹ verfügt eine geringe Zahl über wachsende Einkünfte aus Geldvermögen, ›unten‹ schrumpfen die Sparvermögen, last but not least seit Jahren auch die Reallöhne. Verschärfte Konkurrenz auf dem europäisch ausgeweiteten Arbeitsmarkt mit unterschiedlichem Lohnniveau, die Ketten von Subunternehmen, dazu die – im Sinne der Schaffung von Arbeitsplätzen durchaus sinnvolle – Flexibilisierung von Arbeitszeiten drücken in vielen Bereichen auf das Lohnniveau. Dazu kommt hierzulande eine Steuer- und Subventionspolitik (e.g. Strompreise), die die unteren Einkommen spürbarer belastet.
Zu den Hinterlassenschaften der Ära Clinton gehörte die – im Widerspruch zur Deregulierung – als sozialpolitische Maßnahme zum Erwerb von Wohneigentum gedachte, gesetzliche Auflage an die Banken, Kredite ohne plausible Sicherheiten (collaterals) zu gewähren. Es war dies einer der Faktoren, der im Jahr 2008 die Bank Lehman Brothers zum Fallieren brachte und in Folge die internationale Finanzkrise herbeiführte. Der Zusammenbruch des auf ungesicherten privaten Krediten und – in den ›Südstaaten‹ – auf staatlicher Schuldenpolitik basierenden Finanzsystems der EU wurde bekanntlich allein durch die Preisgabe des ›no-bail-out‹-Prinzips von Maastricht durch die großkoalitionäre Regierung Merkel sowie die Nullzins-Politik der EZB unter Mario Draghi aufgefangen.
Von den Gefahren einer aufgeschobenen Hyperinflation abgesehen, sind die Leidtragenden dieser Finanzpolitik – in der EZB ist der Vertreter der Bundesbank nur noch ein minor inter pares – in erster Linie die deutschen Sparer, d.h. die ›kleinen Leute‹ in den unteren Einkommensgruppen. Die Auswirkungen auf den Immobilien- und Wohnungsmarkt sind allenthalben spürbar. Man mag versuchen, durch Mietpreisbremsen, Subventionen, sozialen Wohnungsbau – und Enteignungen – dem Notstand abzuhelfen. Voraussetzung dafür sind sprudelnde Steuerquellen, was wiederum auf die wirtschaftliche Gesamtlage im Zeichen der Globalisierung zurückweist. Entsprechende Parolen wie ›Gerechtigkeitslücke‹ oder ›Profitgier‹ von Immobiliengesellschaften mögen für Wahlkampfparolen taugen, nicht aber zur Analyse der zugrundeliegenden Mechanismen und deren Korrektur.
VII.
Die teils in den neoliberalen Wirtschaftsprozessen selbst angelegte, teils in dazu widersprüchlicher Interventionspolitik angelegte Problematik einer sich öffnenden Schere in – und zwischen – den ›reichen‹ Ländern fällt zusammen mit dem Wandel der Bevölkerungsstruktur in den Industriestaaten. Der auf Abschöpfung (Steuern und Abgaben) und Umverteilung gründende Sozialstaat sieht sich mit alternden, bislang von staatlich abgestützten Versicherungssystemen alimentierten Bevölkerungsgruppen konfrontiert. Die bestehenden Sozialsysteme, einschließlich des Gesundheitswesens, sind von einer – von Konjunkturzyklen abgesehen – anhaltenden Wachstumswirtschaft abhängig.
Wenngleich im Hinblick auf die öffentlich geführten Debatten um ›Nationalismus‹ und ›Fremdenfeindlichkeit‹ politisch inopportun, ist es gedanklich – und letztlich ethisch-moralisch – fahrlässig, Kritik an der ungemindert anhaltenden Einwanderung als ›rechts‹ abzutun, die Armutseinwanderung aus kulturell fremden Ländern und Kontinenten als ›Bereicherung‹ zu fördern. Unübersehbar führt die Einwanderung in vielerlei Bereichen (Sozialhilfe, Schule, Gesundheit) zu Kosten, die nicht mit der Aussicht auf gesamtgesellschaftlichen Nutzen für die alternde ›Mehrheitsgesellschaft‹ sowie für kommende Generationen auszublenden sind. Die Negativphänomene in den ›Problembezirken‹, die sozialen – und politischen – Kosten der evidenten cultural clashes sind schlichtweg nicht zu übersehen.
VIII.
Jede Vision einer besseren, gerechteren, ›höheren Form‹ von Gesellschaft ist – ungeachtet der Vorstellung der Weltgesellschaft (›unser blauer Planet‹), ungeachtet der Existenz internationaler Organisationen wie der UNO sowie transnational etablierter Großunternehmen oder transnational operierender NGOs – noch stets an die Realität einer politischen Gesellschaft, mit anderen Worten an die Existenz eines territorial begrenzten Staates gebunden. Innerhalb dieses Rahmens (›Sozialisierungs‹-Artikel 15 GG sowie Art. 20 (1) GG : »Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.«) geht es idealtypisch um die demokratisch legitimierte Konkurrenz von Konzepten zur bestmöglichen Daseinssicherung der Gesellschaft. Begriffliche Unschärfen bezüglich der ›Gesellschaft‹ kommen in der Ablösung des Begriffs ›Volk‹ durch ›Bevölkerung‹ sowie des ›Staatsvolks‹ durch die antithetisch zum Staat gemeinte ›Zivilgesellschaft‹ zum Vorschein.
Zu erwähnen ist dabei das theoretische Grundproblem der modernen Demokratie: Wer ist der demos, auf welche Weise lässt sich die behauptete ›Volkssouveränität‹ institutionalisieren? Im Begriff des ›demokratischen Verfassungsstaates‹ wird das fiktive Element der Demokratie eben nur verdeckt. Nicht nur in autoritären Staaten, auch in Demokratien fallen permanent Entscheidungen, die vom ›Volk‹ mehr ertragen als getragen sind. Des weiteren: Auf welcher Ebene soll das ›Volk‹ seine demokratischen Rechte ausüben? Am eindrucksvollsten geschieht dies noch immer in den ländlichen Kantonen der Schweiz oder in den town meetings in den ländlichen Gebieten Neu-Englands.
Auf diesem unsicheren Begriffsfeld, in concreto in der sich historisch permanent – heute angesichts anhaltender und staatlich geförderter Einwanderung – verändernden gesellschaftlichen Realität ist die Debatte über Recht und Sinn des ›demokratischen Sozialismus‹ zu führen. Was heißt anno 2019 ›Demokratie‹, welchen politischen Stellenwert kann – nach der umfassenden historischen Desavouierung des ›Realsozialismus‹ 1989/1991 – der ›Sozialismus‹ heute beanspruchen?
Die anstehenden Wahlen zum EU-Parlament veranschaulichen die Problematik des sakrosankten Begriffs ›Demokratie‹ im anscheinend festgefügten Kontext der Europäischen Union. Die Befugnisse des zwischen Straßburg und Brüssel wechselnden Parlaments sind im Verlauf der letzten Jahrzehnte gewachsen, die reale Macht liegt gleichwohl bis dato in den Händen der Europäischen Kommission sowie des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs. Selbst wenn die Vollendung des von nicht wenigen Befürwortern angestrebten Bundesstaats noch ausstehen mag, hat sich die politische Entscheidungsgewalt mehr und mehr in Brüssel konzentriert. Die Kritik am ›demokratischen Defizit‹ der EU ist seit dem Lissabon-Vertrag (2007/2009) nahezu verstummt – und dies nicht etwa wegen des Zugewinns an demokratischer Souveränität seitens der europäischen Bürger in den Mitgliedsstaaten. Kritische Stimmen – ganz abgesehen von der spektakulären Brexit-Parole ›Take back control!‹ – werden mit dem Negativbegriff ›Populismus‹ abgetan.
Die positive, friedenstiftende Bedeutung der EU soll hier nicht Zweifel gezogen werden. Die Auseinandersetzungen über Eurobonds, Ausweitung des EU-Budgets sowie über die Konzepte des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron lenken indes den Blick auf zwei verquickte Problembereiche: Zum einen geht es um unterschiedliche ökonomische Politiken, Interessen und Fragen der Umverteilung (von den ›reichen‹ Nord- zu den schwächeren ›Südstaaten‹), zum anderen um Machtpotentiale samt keineswegs gänzlich verschwundenen Machtprojektionen innerhalb des – begrifflich offenbar bereits obsoleten – ›Staatenverbundes‹ EU. Sieht man ab von der Übertragung des alten europäischen Parteiensystems auf das EU-Parlament, in dem die Sozialdemokraten eine zusehends schwindende Fraktion bilden, geht es bei der auf europäischer Ebene verhandelten Umverteilung – von ›Nettoeinzahlern‹ zu Empfängerstaaten – um teils pragmatische Lösungen, teils um Interessen und/oder Machtpolitik im vorgegebenen Rahmen.
Was die zentrale Einwanderungsproblematik betrifft, so gibt es bezüglich der Sicherung der Außengrenzen und der unübersehbaren Grenzen der ›Integration‹ in den Einzelstaaten inzwischen auch deutliche Unterschiede innerhalb der europäischen Sozialdemokratie. Von den in der EVP versammelten ›Konservativen‹ sind die Sozialdemokraten kaum zu unterscheiden, wohl aber die radikaleren ›linken‹, großenteils postkommunistischen Traditionssozialisten, die teils mit Forderungen nach höheren Transferleistungen, teils faute de mieux mit Vergesellschaftungs-, sprich: Verstaatlichungskonzepten aufwarten.
Wie ist dem skizzierten – für die Stabilität eines Gemeinwesens risikoreichen – Szenario der sich weitenden Schere, kulturell-sozialer Desintegration entgegenzuwirken? Der Ruf nach Bildung/Ausbildung zur Lösung aller Probleme setzt Bildungsbereitschaft und -fähigkeit voraus. Da man in den herrschenden ›Diskursen‹ der Problematik nur mit immer neuen Sozialleistungen – von den Kosten überfüllter Justizstrafanstalten ganz abgesehen – bzw. mit immer neuen Ausgaben der öffentlichen Hand glaubt begegnen zu können, stellt sich an diesem Punkt die Frage der Funktionsfähigkeit und Belastbarkeit eines exportabhängigen Wirtschaftssystems. Spätestens zu dem Zeitpunkt, da China auf deutsche Industrieprodukte nicht mehr angewiesen ist, ist auch der deutsche Sozialstaat am Ende.
IX.
Welche politische – und politisch-moralische – Qualität besitzt in dem skizzierten Rahmen der ›demokratische Sozialismus‹? Wie steht es mit dem ›demokratischen Sozialismus‹ auf der Ebene der derzeit noch existierenden europäischen Nationalstaaten, insbesondere in dem 1989/90 wieder erstandenen deutschen Nationalstaat im Kontext der EU? Es geht um die demokratischen Grundfragen zur Kontrolle und Zuteilung von Macht in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Es geht um ›Herrschaft von unten‹, um Partizipation, Mitbestimmung, Medienzugang, um Besteuerung, um Ausgaben und Investitionen der öffentlichen Hand sowie last but not least um das kulturelle Selbstverständnis einer res publica.
Inwieweit Wirtschaftsprozesse im europäischen und internationalen Rahmen – gemäß alten staatsinterventionistischen und/oder Verstaatlichungskonzepten – ›demokratisch‹ zu steuern sind, bleibt angesichts der globalen Gegebenheiten und bestehender Institutionen (e.g. IWF, Weltbank, EZB) eine diskussionswürdige Frage. There is no alternative ist sowenig eine Antwort auf die großen Fragen wie Parolen von Klassenkampf und internationaler Solidarität. Über die in der Finanzwelt übliche Ausschüttung von exorbitanten Boni für erfolgreiches Management wäre fraglos zu reden. (Schwieriger wäre dies bereits – wegen des von vielen Wählerinnen und Wählern geschätzten Unterhaltungswertes des Sports – bezüglich der heute ausgehandelten Einkommen für ›Spitzensportler‹.)
Voraussetzung für das Gedeihens eines Staatswesens ist – bekannt seit Aristoteles – die Existenz einer materiell gesicherten Mittelschicht. Reformistisches sozialdemokratisches Bestreben zielte von Anbeginn auf die Überwindung von Klassengrenzen und den materiell begründeten Einbezug der benachteiligten Unterschichten ins staatstragende Bürgertum (im weitesten Sinne des Begriffs). Wann immer ökonomisch-soziale und kulturelle Zerklüftung zu konstatieren ist, ist das Konzept eines ›demokratischen Sozialismus‹ zum Zwecke konfliktmildernder, umfassende Solidarität begründender Zustände innerhalb eines Staates plausibel und begrifflich sinnvoll.
Der Begriff setzt aber ein historisch-politisch begründetes Selbstverständnis der Republik als ›Nation‹ und ein darin begründetes Verständnis der Notwendigkeit von ›Solidarität‹ voraus. Ein derartiges Verständnis von ›Solidarität‹ wäre – unter der Bedingung wechselseitigen Vertrauens, des Verzichts auf billige Vorteilnahme sowie widerspruchsfreier, klarer, Erfolg verheißender Konzepte – auch auszuweiten auf die europäischen Partner in und außerhalb der EU. Der eigentliche Bezugsrahmen – im Kontext dessen, was dereinst als ›soziale Marktwirtschaft‹ etabliert wurde – bliebe indes der Nationalstaat.
All das ist in der Gegenwart in der gesellschaftlichen Realität der Bundesrepublik kaum noch vorzufinden. Die Realität einer multiethnisch-multikulturell desintegrierenden Gesellschaft, in der kulturell-sozial disparate Gruppen ihre politischen – materiellen und kulturspezifischen – Ansprüche verfolgen, steht dem Konzept demokratisch-sozialistischen Gemeinsinns sowie historisch gewachsener Verantwortung evident entgegen. Solange Sozialisten oder Sozialdemokraten sich der kulturellen Aspekte der sich durch Immigration grundlegend verändernden Gesellschaft verweigern, ist der Begriff des ›demokratischen Sozialismus‹ hinfällig. Praktikable Handlungskonzepte birgt er zumindest derzeit nicht mehr.