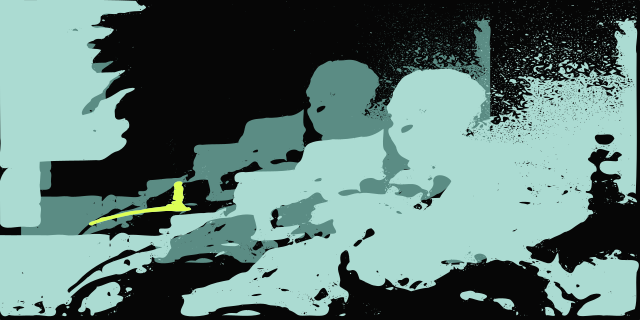von Peter Brandt
Der Adressat linker Politik war bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wie selbstverständlich das »arbeitende Volk in Stadt und Land«, wie im Görlitzer Programm der SPD von 1921 und ganz ähnlich im Wiedergründungsaufruf der KPD 1945 formuliert. Nicht von Ungefähr: Über neun Zehntel der Erwerbsbevölkerung waren und sind abhängig Beschäftigte, der Rest setzt sich überwiegend aus kleinen Selbstständigen zusammen. In einer solchen Situation sollen, ja müssen linke Parteien Volksparteien sein. Dies aber nicht in dem Sinne, dass der Multimillionär den gleichen Anspruch auf Berücksichtigung seiner Interessen erheben darf wie der nicht-privilegierte Arbeitnehmer.
Die Sozialdemokratie als die in den meisten europäischen Ländern ehedem größte Formation links der Mitte hat sich von ihrer Klientel entfernt, indem sie die Hinwendung zu den Rand- bzw. Sondergruppen und deren Themen kombiniert hat mit einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die die Hinnahme der vom Finanzmarkt getriebenen, neoliberalen Globalisierung als unumgänglich zu erkennen meinte. Den Anfang machte Tony Blairs New Labour; in Deutschland lauteten die Stichworte »Agenda 2010« und »Hartz IV«. Die damit verbundenen Maßnahmen beseitigten weder den spezifischen deutschen, korporativ geprägten »Realtypus von Kapitalismus und bürgerlicher Gesellschaft« (W. Abelshauser) im Allgemeinen, noch den hierzulande seit den 1880er Jahren installierten und seit den 1950er Jahren zu einer neuen Qualität ausgebauten Sozialstaat im Besonderen. Doch sie beschädigten und reduzierten ihn im Hinblick auf die soziale Absicherung. Das ökonomische Wachstum Deutschlands nach der Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 2008/09 ist, wie schon früher, durch eine Exportoffensive zuwege gebracht worden, zum erheblichen Teil ermöglicht durch Lohndumping. Der derzeitige, relativ hohe Beschäftigungsstand hierzulande ist großenteils erkauft durch die Zunahme von Teilzeit- bzw. prekärer Beschäftigung und wird nicht zufällig begleitet von gravierender Erwerbslosigkeit im Süden des Kontinents.
Die ersten drei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren in Westeuropa deshalb eine günstige Periode für die sozialdemokratischen Parteien und die Gewerkschaften, weil der Wiederaufbau und die folgende, kaum durch Rezessionen unterbrochene Boomphase Raum bot für einen längerfristigen Kompromiss (gewiss nicht konfliktfrei) zwischen Staat, Kapital und Arbeit – mit einer historisch einmaligen Steigerung des Lebensstandards auch der unteren Hälfte der Bevölkerung und einem Ausbau des Sozialstaats hin zu einer neuen Qualität. Die gleichzeitige Errichtung und Befestigung einer nichtkapitalistischen, vermeintlichen sozialistischen, diktatorischen Ordnung in Südosteuropa und im östlichen Mitteleuropa, namentlich im östlichen Teil Deutschlands, wirkte auf die breiten Schichten der Lohnabhängigen, auch auf die Kernschichten der Industriearbeiterschaft, wenig attraktiv, sogar eher abstoßend; indessen förderte der Systemkonflikt auf westlicher Seite die Bereitschaft der Oberklasse, den Lohnabhängigen Zugeständnisse zu machen, nicht nur solche materieller Art.
Die neoliberale Wende der Politik in der kapitalistischen Welt nach der internationalen Wirtschaftskrise von 1974/75, ausgelöst, aber nicht hauptsächlich verursacht durch eine deutliche Ölpreiserhöhung seitens des Kartells der OPEC-Länder, entsprang nicht reiner Willkür: Abnehmender Produktivitätszuwachs und die starke Position der Gewerkschaften brachten die Kapitalseite in eine Profitklemme. Die Fortsetzung des Modells regulierter Marktwirtschaft und avancierten Sozialstaats kollidierte mit den Grundprinzipien kapitalistischen Wirtschaftens, so dass die Sozialdemokratie zunehmend vor die Alternative gestellt war, sich irgendwie anzupassen oder eine größere Konfliktbereitschaft zu entwickeln – ohne dass klar war, ob der bisherige Weg unter den veränderten Bedingungen überhaupt weiter gangbar sein würde, zumal die ökologischen Grenzen des Wachstums ins Bewusstsein zu treten begangen.
Auffällig ist nicht nur der fast kontinuierliche Abstieg der SPD seit der Jahrtausendwende, eine prozentuale Halbierung bei Bundestagswahlen binnen 20 Jahren (ähnlich in der Mitgliederentwicklung), sondern auch die Tatsache, dass das rot-rot-grüne Lager von einer satten Mehrheit 1998 auf inzwischen ganze 38,6 Prozent zusammengeschmolzen ist. Eine entsprechende Regierungsbildung ist derzeit somit schon rechnerisch ausgeschlossen. Womit wir beim heutigen Rechtspopulismus wären, dem es, mit Ausnahmen vor allem in Griechenland und auf der Iberischen Halbinsel, gelungen ist, europaweit den sozialen und politischen Protest gegen die globalisierten Eliten sowie das internationale Finanzkapital und den von diesen Kräften bestimmten beschleunigten Wandel auf ihre Mühlen zu lenken. Die betreffenden Wählersegmente scheinen, um bei Deutschland zu bleiben, nicht nur für die SPD mittelfristig verloren. Auch Die Linke kann, anders als bis vor einigen Jahren zumindest in Ostdeutschland, dieses Protestpotential aktuell nicht mehr erreichen. Es widerstandslos der Rechten zu überlassen, wäre indessen die politische Kapitulation der Gesamtlinken schlechthin.
Eine undifferenzierte und unkritische Bejahung »Europas« ist z.B. deshalb schwer zu vermitteln, weil es in erster Linie darum geht, welche Art Vereintes Europa mit welcher institutionellen Ordnung und welcher wirtschafts-, gesellschafts- und außenpolitischen Orientierung angestrebt werden soll: Schutz- und Gestaltungsraum oder Katalysator der marktkapitalistischen Globalisierung? Die Nation ist für die Mehrheit der Menschen überall auf der Welt weiterhin die primäre Bewusstseins-, Gefühls- und Kommunikationsgemeinschaft, die nicht im Gegensatz stehen muss zu einem immer engeren europäischen Verbund. Der Nationalstaat bleibt der bislang einzige gesicherte Rahmen für Rechtsstaat und Demokratie, auch wenn er sukzessive Kompetenzen an übernationale Einrichtungen abgegeben hat und möglicherweise weiter abgeben wird.
Es ist nicht zu leugnen, dass die Globalisierung den Gestaltungsraum linker Politik eingeengt hat, so durch den internationalen Steuersenkungswettbewerb. Gerade hier wäre die EU gefordert. Und selbst auf nationalstaatlicher Ebene könnte wesentlich mehr zur Re-Regulierung der Wirtschaft, zur Aufrüstung des Sozialstaats und zur Umverteilung der Einkommen und Vermögen von oben nach unten geschehen als behauptet wird. Die neoliberale, kapitalfreundliche Politik der europäischen Institutionen und der Brüsseler Bürokratie sowie das (wenn auch inzwischen verkleinerte) Demokratiedefizit der EU muss thematisiert werden, anstatt es aus Furcht vor Nationalismus hinter wohlfeilen proeuropäischen Floskeln zu verbergen.
Die Ablehnung der Zuwanderung nach Europa, namentlich nach Deutschland, aus dem globalen Süden wird vielfach als wichtigstes Motiv bei der Unterstützung rechtskonservativer, rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien angesehen. Immerhin wäre es bei der Diskussion, auch innerhalb des linken bzw. Mitte-links-Spektrums, hilfreich, zwischen Flüchtlingen im engeren Sinn sowie Armutsflüchtlingen und Migranten aus anderen Motiven andererseits zu unterscheiden. Die Stimmungsmache von rechts gegen Asylsuchende und Einwanderer sowie deren Helfer und Unterstützer darf nicht mit systematischer Verharmlosung der damit verbundenen Schwierigkeiten und Missachtung der Verunsicherung ohnehin benachteiligter Einheimischer beantwortet werden. Denn sie könnten am Ende die Leidtragenden sein.
Es wäre die Aufgabe einer revitalisierten und volksverbundenen Linken, die Formel von der »Beseitigung der Fluchtursachen« ins Zentrum der diesbezüglichen politischen Auseinandersetzung zu rücken. Dabei ginge es im Wesentlichen um die Realisierung der schon vor vier Jahrzehnten von der Nord-Süd-Kommission (»Brandt-Kommission«) gemachten Vorschläge zur Beseitigung der Strukturmängel und Dysfunktionalitäten im Verhältnis der nördlichen zur südlichen Hemisphäre, die eine nachhaltige Entwicklung hemmen. Beseitigung! Nicht allein um die Reduzierung des krassesten Elends. Die Beziehungen der kapitalistischen Metropolen zur früher so genannten Dritten Welt sind auch viele Jahrzehnte nach Erreichen der staatlichen Unabhängigkeit von Abhängigkeits- und Ausbeutungsstrukturen gekennzeichnet. In den derzeitigen, äußerst blutigen kriegerischen Verwicklungen, die Massenflucht produzieren, sind die großen Militärmächte, vor allem die USA, in der Regel zumindest indirekt beteiligt. Zudem: Knapp dreißig Jahre nach Beendigung des alten Ost-West-Konflikts wird ein neuer, durchaus gefährlicher, finanzielle Mittel und Energien bindender Rüstungswettlauf in Gang gesetzt, hierzulande wie anderswo im Westen befeuert von einer hypermoralisch aufgeladenen Menschenrechtspropaganda, die die Lehren der Entspannungspolitik der 1960er bis 80er Jahre ignoriert.
Dabei ist klar, dass die Linke sich nicht auf die heimische soziale Frage im engeren Sinn beschränken kann. Das gilt umso mehr, als die ökologische Krise von existentieller Art und letztlich nur global lösbar ist. Das ist inzwischen auch der Mehrheit der Bevölkerung bewusst geworden. Die fundamentalen Menschheitsprobleme werfen die Systemfrage auf, ohne dass wir das Ziel und die einzelnen Schritte der rettenden Transformation heute im Detail bestimmen könnten. Dass das Ostblock-System eines angeblich »real existierenden Sozialismus« vor 1990 keine praktikable und humane Alternative war, ist nicht erst seit 1989 offenkundig und von kritischen Sozialsten, den Autor eingeschlossen, stets betont worden: Es wird entweder einen demokratischen Ausweg aus der Krise der Menschheit geben oder gar keinen. Das heißt aber nicht, dass der Kapitalismus das letzte Wort der Geschichte sein wird.
Die drei Parteien, die in unterschiedlicher Intensität und Akzentuierung mit einer kritischen Haltung zum gesellschaftlichen Status Quo angetreten sind, haben sich zunehmend als unfähig erwiesen, dem Wunsch nach Veränderung und den damit verbundenen Erwartungen der Menschen Ausdruck zu verschaffen. Die erwähnte, noch so unbestimmte Orientierung auf eine Transzendierung des Kapitalismus, jedenfalls des real existierenden war und ist bislang das eine Alleinstellungsmerkmal der SPD unter den etablierten Altparteien, das zweite die spezifische, gewissermaßen organische Verbindung mit den Gewerkschaften und lange Zeit auch zu breiten Arbeitnehmerschichten.
Die Gewerkschaftsnähe ist spätestens seit Verkündung der Agenda 2010 erheblich gelockert, aber immer noch stark und von besonderer Art, besonders auf der Spitzenebene. Auch wenn sich der Punkt schwer benennen lässt, an dem die SPD aufhören würde, eine sozialdemokratische Partei in der tradierten Wortbedeutung zu sein, kann eine solche letztendliche Umwandlung nicht ausgeschlossen werden. Eventuell könnte dies auch durch andauernde Schrumpfung geschehen, so dass das übrig Bleibende nicht mehr als eigenständiger Faktor agieren könnte und mangels Einflusses z.B. auch für die Gewerkschaften nicht mehr interessant wäre. Zu warnen ist allerdings vor der Illusion, die Grünen bzw. die Linkspartei würden das Potential ggf. im großen Umfang erben.
So wie die Dinge liegen, ist ein Ausweg für die SPD schwer zu erkennen, zumal die angekündigte »Erneuerung« hauptsächlich auf ein »moderneres« Erscheinungsbild, verstärkte digitale Präsentation und Diskussion hinauszulaufen scheint. Nimmt man die weniger düsteren, aber im Sinne der weitreichenden Ziele ebenfalls verbauten strategischen Optionen der beiden anderen relativ linken Parteien hinzu, dann gewinnt der seit einigen Monaten diskutierte Gedanke einer linken Sammlungsbewegung an Attraktivität. Es geht darum, die bestehenden Formationen, die aus sich selbst heraus den Weg zur Masse des Volkes nicht oder nicht mehr finden, zu beeinflussen und zu mobilisieren.
Dass es auch in den am meisten entwickelten Staaten des Westens ein großes Potential für einen Neuansatz gibt, insbesondere unter jungen Leuten, haben – bei allen offenkundigen Besonderheiten – die Kampagnen von Jeremy Corbyn und Bernie Sanders mit ihren jeweiligen Inhalten gezeigt, deren Erfolg bzw. relativer Erfolg die Medien überrascht hat. Insbesondere Sanders vermochte ein beträchtliches unzufriedenes Wählersegment anzusprechen, das die mit der Finanzindustrie liierte, als Inkarnation des Washingtoner Establishments daherkommende Hillary Clinton keineswegs wählen wollte.
Die vorgeschlagene Sammlungsbewegung wäre keine neue Partei und hätte auch nicht das Ziel, eine solche zu werden. Sie wäre ein Personenzusammenschluss, der die Mitgliedschaft und Mitarbeit in Parteien und anderen Vereinigungen nicht nur nicht ausschließen, sondern sogar fördern sollte. In der SPD gibt es z.B. eine große Zahl langjähriger und der Tradition der Partei verbundener Mitglieder, die nie austreten werden, aber längst nicht mehr in den Gliederungen oder anderweitig präsent sind. Spötter sprechen von den unzufriedenen Sozialdemokraten als der größten SPD-Arbeitsgemeinschaft. Darüber hinaus ginge es darum, Parteilose einzubeziehen – Betriebs- und Personalräte, untere Gewerkschaftsfunktionäre, sozialkritische Christen beider Konfessionen, Umweltaktivisten, Globalisierungskritiker, Friedensbewegte – und solche, die sich bisher noch gar nicht engagiert haben. Der Idee der Sammlungsbewegung wird entgegengehalten, dass der Anstoß dazu von unten kommen müsse. Doch wenn die Zeichen nicht trügen, warten viele Menschen auf ein Signal derer, die eher die Chance haben, sich öffentlich zu artikulieren.
Der vollständige Artikel ist unter dem Titel Wir brauchen eine linke Ökumene. Plädoyer für eine Sammlungsbewegung links der Mitte auf den Seiten des ipg-journals (Internationale Politik und Gesellschaft) abzurufen:
https://www.ipg-journal.de/rubriken/soziale-demokratie/artikel/wir-brauchen-eine-linke-oekumene-2910/