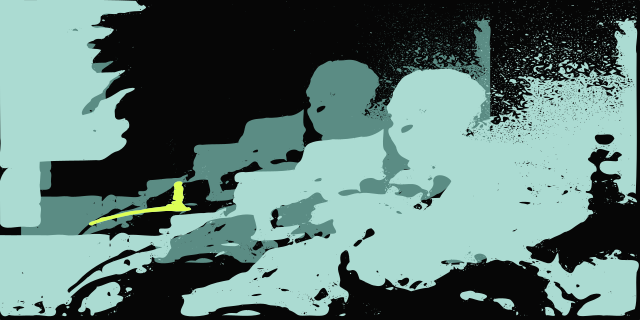von Ulrich Siebgeber
Norbert Lammert, FAZ Online vom 4.1.2017
1.
Sagt das Ei zur Henne: »Sie haben sich im Wesentlichen erledigt.« Wie das? Hat ihm das ein Verfassungsrichter souffliert? Oder ein Parlamentspräsident? Dass sich die Volkssouveränität »insbesondere in der Setzung einer Verfassung ausdrücke« und sich »damit im Wesentlichen erledigt« habe – so ein Satz, vom amtierenden Parlamentspräsidenten in die gegenwärtige politische Situation geworfen, als habe sich das Ei des Kolumbus endlich Mitspracherechte im Zentrum der Macht erworben, drückt etwas aus, was vielleicht unausgedrückt, als Ferment des Rechts- und Verfassungsstaates, bessere Dienste leistete. So, als politisches Statement, wirft er ein Licht auf die juristische Verwerfung im Selbstverständnis mancher Diener eines Staates, der in der Vergangenheit oft und gern als freiester Staat auf deutschem Boden bezeichnet wurde – was Spötter mangels Konkurrenz stets als ›nicht so schwierig‹ bezeichneten. Zu Unrecht, wie sich nach und nach herausstellt. Freiheit ist schwer – und keineswegs leicht zu begreifen. Man kann sich an ihr auch verheben.
2.
Die Bedeutung eines juristischen Satzes ist in der Regel eine rechtliche – keine politische. Im gegebenen Fall liegt das auf der Hand: Es ist der Souverän, der sich eine Verfassung gibt, und nicht die Verfassung, die, etwa mittels irgendwelcher Unterparagraphen, den Souverän (das Volk) erzeugt. Wird so ein Satz, wie hier geschehen, im politischen Feld zitiert, um populistisch erregte Gemüter abzukühlen, verwandelt er den Souverän in eine Art Gespenst, von einer gütigen Fee in die Flasche Verfassung gebannt und ins Meer der Tagesgeschäfte geworfen, in denen es nur die Alternative Regieren oder Regiertwerden gibt.
3.
Das souveräne Volk, das sich in Freiheit und Selbstbestimmung eine Verfassung gibt, ist eine juristische Fiktion und gleichzeitig die machtvollste aller politischen Realitäten, falls darunter nicht nur das herrschaftliche Aufgebot von Polizei und Armee verstanden werden soll. Die Frage, wie und an welcher Stelle sie in Erscheinung tritt, muss Juristen nicht weiter bekümmern, solange die verfassungsmäßige Ordnung intakt ist und von ihren Bürgern respektiert wird. ›Erledigt‹ heißt in diesem Sinne nur: Es ist geschehen und wir wollen – aus reiflich erwogenen Gründen – nicht weiter daran rütteln. Daran rütteln kann nur das Volk selbst, sofern es politisch in Aktion tritt. Doch wann geschieht so etwas? Wann geschieht es wirklich und nicht nur in den Köpfen einer Handvoll Aufrührer oder Unbelehrbarer? Die juristische Fiktion ›Volkssouveränität‹ gibt darauf keine Antwort und kann, vom Widerstandsrecht des Einzelnen abgesehen, keine darauf geben. Sie beantwortet sich, nie ganz eindeutig, im politischen Bewusstsein der Handelnden, die für ihr Handeln einstehen und die Folgen bedenken müssen, die sich aus ihm ergeben.
4.
Eines ist es, eine geltende Verfassung in Frage zu stellen, ein anderes, ihre Gestaltungsräume auszuloten. Ist das ›Volk‹ erst einmal aus dem politischen Raum diffundiert und existieren bloß noch seine gewählten Repräsentanten und ihre Hofberichterstatter, dann fällt paradoxerweise der Verfassung, gleichsam als Merkzeichen seiner unverrückbaren Anwesenheit, die Aufgabe zu, die Gewählten davor zu bewahren, es mit der Grenzenlosigkeit des Regierens zu weit zu treiben. Aus genau diesem Grund ist im demokratischen Verfassungsstaat die Berufung auf die Verfassung politisch geboten und gehört zu jedermanns Rechten. Damit sollte sich übrigens auch die Bedeutung des Appells »Wir sind das Volk« klären lassen, es sei denn, man verstünde ihn als revolutionäre Losung oder den Versuch der Neukonstitution eines separaten Gemeinwesens. Natürlich liegt hier per se keine juristische Einrede vor, sondern eine politische. Entsprechend kommt es nicht auf die Anzahl derer an, die sich hinter sie scharen, sondern auf die Wirkung, die sie entfaltet. So ein Schuss kann auch nach hinten losgehen. Die Frage »Wer seid ihr, die ihr beansprucht, das Volk zu sein?« ist ebenfalls legitim und muss gestellt werden. Wer keine Antwort darauf zu geben weiß oder zu irrealisieren beginnt, hat seinen Kredit schnell aufgebraucht. Das ändert nichts daran, dass die Differenz zwischen dem Volk und seinen Vertretern stets virulent bleibt und zu gewissen Zeiten nach Ausdruck verlangt.
5.
Was ist das Volk? Wer ist das Volk? Was zeichnet dieses Volk (neben anderen) aus? Das sind drei unterschiedliche Fragen, die unterschiedliche Antworten verlangen. Wer, wie Lammert, der Auffassung ist, ›das Volk‹ bestimme sich, das heißt seine Zusammensetzung und seine Art, da zu sein, im Wesentlichen selbst, wird gewöhnlich bereits an der Grenze des betreffenden Staatsgebietes, mitunter unsanft, eines Besseren belehrt, es sei denn, er hegt eine natürliche Abneigung gegen Grenzen und meidet sie, wo er kann. Des weiteren gibt es innere Grenzen: Wer immer zu ›bestimmen‹ unternimmt, wie das Volk zu sein wünscht und was es sich unter sich selbst vorstellt, darf mit Widerstand rechnen. Auch hier trifft der Satz zu: Jeder ist ›Volk‹, aber nicht ›das Volk‹. Das gilt auch für jene, die es schon länger regieren – und ihre gelegentlich einsamen Beschlüsse.
6.
Wenn es klug und nützlich sein kann zu behaupten, das Volk bestimme sich selbst, dann muss es auch klug und nützlich sein, die Grenzen zu bestimmen, innerhalb derer dies geschieht. Was die inneren Grenzen angeht, so ergeben sie sich im Prozess der Verständigung selbst, der die ›Bestimmung‹ vorantreibt. Weder die treibenden noch die retardierenden Kräfte haben hier irgendein Recht auf ihrer Seite: Tradition, kulturelle Ideale, Menschheitsziele fallen gleichermaßen ins Gewicht, wenn es um das Verständigtsein des Souveräns mit sich selbst zu tun ist. Auch die Verfasssung kann letztlich nur Ausdruck dieser Selbstbestimmung sein. Sie unterliegt dem Wandel der Selbstauffassung und des Selbstverständnisses des ›Volkes‹, soll sie nicht irgendwann zu einem ›Stück Papier‹ verkommen, das nur noch Traditionalisten wert und teuer ist. Die Benennung unabänderlicher Grundrechte innerhalb der Verfassung widerspricht dieser Auffassung nicht, sondern erläutert sie: Die Grundrechte sind gerade nicht identisch mit der Verfassung. Sie sind das von ihr garantierte Minimum, jenseits dessen Kontinuität und Wandel zu einem gesetzgeberischen Ausgleich kommen müssen. Die Mindestanforderung an eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament leitet sich nicht bloß aus dem Bedürfnis nach Kontinuität her, sondern ebenso sehr aus dem nach angemessenem Wandel. Sie dient dazu, die Fiktion der Volkssouveränität glaubhaft zu erhalten und der Realität des ›Volkes‹, das heißt dessen, womit jeder innerhalb der Grenzen des Gemeinwesens leben kann, Rechnung zu tragen.
7.
Das alles ist wesentlich politisch gedacht, so wie ›Souverän‹, ›Volk‹, ›Verfassung‹ im Wesentlichen politische Begriffe sind, die allerdings der juristischen Ausgestaltung bedürfen, um den Ansprüchen des Rechtsstaats Genüge zu leisten. Was abgegolten oder ›erledigt‹ ist, bestimmt sich im politischen Feld je nach historischer Konstellation und pragmatischem Kontext von Mal zu Mal neu, das betörende Wörtchen ›endgültig‹ findet hier keinen Platz, es sei denn, einer der Akteure räumt unwiderruflich den Platz. Aber was heißt schon ›unwiderruflich‹?
Und kehret wieder sich um.
Gehet in Trauer gehüllet,
Streuet Asche herum.
Georg Heym
8.
Ein Beispiel dafür, das heute alle beschäftigt, die sich dem Gemeinwesen verpflichtet fühlen, ist die Herausforderung des säkularen Staates durch religiöse Gegenentwürfe, ein anderes das möglicherweise bereits ›epochal‹ zu nennende Ereignisfeld der Massenmigration, von einigen Historikern voreilend als ›Völkerwanderung‹ betitelt, womit der Begriff des ›Volkes‹ ein weiteres Mal ins Spiel kommt. Denn auch dieser Begriff ist, wie gesehen, durch den des Souveräns keineswegs ›erledigt‹, vielmehr fordert einer den anderen immer wieder heraus – wie das zu gehen pflegt, wenn Begriffe wechselnde Realitätsaspekte beschreiben und nicht einfach im aseptischen Raum terminologischer Reinheitsgebräuche aneinanderstoßen.
9.
Man sollte in der Frage, wer Deutscher sei, die Relativierung des Abstammungsprinzips durch den Gesetzgeber nicht unterbewerten, aber auch nicht unnötig dramatisieren: Sie war an der Zeit und damit ›fällig‹ – ein Abschluss nach einem Jahrhundert ethnisch motivierter Verbrechen und Verwerfungen, kein Neuanfang. Nicht ohne Grund umfasst der Rassismus-Begriff der neuen Antirassisten neben der ethnischen eine Reihe weiterer Komponenten, darunter die religiöse. Das leuchtet nicht jedermann ein, kommt aber dem Bedürfnis entgegen, die neuen Konfliktlinien in heterogenen Gesellschaften übergreifend zu benennen. In gewisser Weise sucht sich der neue kämpferische Antirassismus seine Konflikte. Was heute als racial profiling auf Widerspruch stößt, ist kein Rassismus alter Schule, sondern ein konfliktgeborener Schematismus, der nicht durch Begriffsarbeit verschwindet, solange der oder die Konflikte selbst bestehen bleiben. Ob die Polizei sich seines Gebrauchs ›schuldig‹ macht oder nicht, ist eine Debatte unter Scheinheiligen, solange die Frage, was sie denn stattdessen machen sollte, wenn es nun einmal um diesen und keinen anderen Konflikt geht, gänzlich ungeklärt bleibt: unverhältnismäßig ist stets die Vorgehensweise, nicht die Feststellung der Konfliktparteien. Fatalerweise bricht an diesen neuen Konfliktlinien, die offenbar bereits das gesellschaftliche Orientierungsvermögen der Ordnungskräfte und ihrer Kritiker überfordern, ein Volksverständnis auf, dessen begriffliche Klärung noch in den Sternen steht, während seine gesellschaftliche Dimension sich jedenfalls nicht in der Forderung nach Plebisziten auf Bundesebene erschöpft.
10.
Verstanden hat das vermutlich die Kanzlerin, die mit ihrer Unterscheidung derer, die schon länger hier sind, von denen, die noch nicht so lange hier sind, einen Treffer im begriffsfreien Raum landete, der selbst Widerstrebende in seinen Bann zieht. Hohn ist schließlich eine Form der Anerkennung und Lästerung eine der vielen Ausgeburten der Hörigkeit. Wer in Zeiten der Masseneinwanderung skandiert, »Wir sind das Volk«, der verkündet damit zweifellos, neben anderem: »Wir sind schon länger hier«. Wer allerdings, auf bequemen Parlamentsstühlen sitzend, meint, damit habe es sein Bewenden und ein mehr oder minder barsches »Platz da« sei das angemessene Mittel, um die Verhältnisse wieder zu ordnen, der sollte bedenken, dass Repräsentation – und damit Demokratie – nur dann funktioniert, wenn die Regierten sich in Regierung und Opposition auch repräsentiert sehen. No taxation without representation. Auch in dieser Hinsicht ist Repräsentation Arbeit – das immerhin sollte dem parlamentarischen deutschen Arbeitsgemüt einleuchten. Zum Volk jedenfalls, wie immer es sich gestaltet und von den Sprachmeistern erhört wird, gehört das Aufbegehren dazu – eine Staatsauffassung, die ihm das wegschneidet, wäre weder demokratisch noch liberal noch sozial zu nennen, sie wäre, ehrlich gesagt, kaum als ›Auffassung‹ erkennbar.
11.
Wie der Kampf gegen den Terror die Zahl der Terroristen vermehrt, so vermehrt der Kampf gegen den Populismus die Zahl der Populisten. Das ist zwar kein Naturgesetz, aber die notwendige Folge von Ausgrenzung, vor allem in ihrer sich selbst entgrenzenden Form: Populist ist, wer das Spektrum politischer Optionen im Blick auf virulente, aber nicht repräsentierte Auffassungen erweitert. Wer kann das sein? Wer begeht diesen schrecklichen Fauxpas immer wieder? Das kann nur jemand sein, der Grenzen nicht respektiert, die aus gutem Grund gezogen wurden. Der ›gute Grund‹, nicht das Gutmenschentum ist die Wurzel der Unfähigkeit seitens der ›etablierten‹ Parteien, den Prozess der Ausgrenzung zu beenden und das politische System wieder instand zu setzen. Der gute Grund setzt eine Grenze, hinter der die schlechten Gründe beginnen, eine Sumpfregion, in der, wer in sie einzudringen wagt, notwendig verlorengeht. Die schlechten Gründe müssen nicht untersucht werden, wir haben sie verloren gegeben, als es gut und notwendig war, Grenzen zu ziehen und ältere Wege der Politik zu verlassen, die nicht länger als zielführend angesehen wurden.
12.
Zwischen Wahrnehmungen und Konzepten verläuft eine feine Linie: Wer sich auf sie konzentriert, dem verschwimmt sie, wer sie aus dem Auge verliert, den bestraft das Leben: Systeme kollabieren, Staatsverbände verlieren ihren Zusammenhalt und lösen sich auf, Ziele verschwinden vom Radar, während sie weiter beschworen werden, politische Existenzen verwandeln sich bis zur Inexistenz. Das alles geschieht, es geschieht vor den Augen der Akteure und sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Selbst wenn sie es wüssten, so änderte sich für sie nichts – so sehr sind sie eingebunden in das, wofür sie stehen. Stünden sie für etwas anderes, so wären sie andere, denen es keineswegs anders ginge. Handeln im politischen Feld enthält die Möglichkeit des Scheiterns, weil es in hohem Maße auf Konzepten beruht. Auch die erfolgreichen unter ihnen scheitern irgendwann an der Wirklichkeit, nicht weil sie mit einem Mal falsch wären, sondern weil ihre Zeit – aus einer Vielzahl schwer entwirrbarer Gründe – abgelaufen ist. Aus guten Gründen werden dann weniger gute, aus für schlecht gehaltenen Gründe, mit denen man sich notgedrungen beschäftigen muss, will man nicht schrumpfen oder untergehen. Wer es, aus Gesinnungsmotiven, vorzieht zu schrumpfen, der weiß, dass er damit Platz für neue Akteure freiräumt und sollte nicht das Gemeinwesen zur Geisel seiner Überzeugungen machen, so lieb sie ihm sein mögen.
13.
Nichtpolitiker, Leute, denen es gut oder schlecht geht und die, zu Recht oder Unrecht, die Gesellschaft oder die Verhältnisse oder den Staat oder die Politiker dafür verantwortlich machen, brauchen dafür keine Konzepte. Ihr Konzept ist das Verantwortlichmachen, schließlich sind sie das Volk und haben die da oben dafür gewählt, dass es ihnen gut geht. Ihre Wahrnehmung mag verkehrt sein oder verzerrt oder krass oder getrübt, sie ist und bleibt Wahrnehmung. Mögen die da oben oder die Parteien, aus denen sie kommen, Konzepte schneidern – sobald die Fühlung mit den Wahrnehmungen der Vielen schwindet, stehen sie auf verlorenem Posten. Platt-autoritäre Blickverweigerung ist kein Rezept für eine rationale, geschweige denn für eine demokratische Politik. Aus diesem und keinem anderen Grund ist die Rede vom ›Populismus‹ leer. Sie füllt sich aber rascher, als es das Parteibuch erlaubt, mit Ressentiment, Missgunst, persönlicher Ranküne und aggressiven Sündenbock-Phantasien: keine gute Voraussetzung, um in den kommenden Auseinandersetzungen zu bestehen. Ausgrenzung funktioniert nur, solange die Machtverhältnisse stabil sind. Wandeln sie sich, wird rasch zum Ausgegrenzten, wer gerade noch glaubte, er beherrsche das Spiel.
14.
Alle heutige Politik ist Bevölkerungspolitik. Das ist weder gut noch schlecht, es ist die Realität, der sich Regierende und Regierte zu beugen haben, gleichgültig, ob sie es mögen oder nicht. Das souveräne Volk der Verfassung ist ebensowenig eine ethnische Größe wie das gemeine Volk, das jeder Beschreibung spottet und als mit Pass und Staatsbürgerschaft ausgestattete ›Bevölkerung‹ Ansprüche auf die Gestaltung des von ihm bewohnten Landes erhebt. Das schließt, wie die Erfahrung lehrt, ethnisch-kulturelle wie ethnisch-religiöse Konflikte nicht aus. Man mag sie ›bösartig‹ nennen, aber bösartig sind vor allem die einschlägigen Gesinnungen sowie die ihnen zu verdankenden Taten: Konflikte, einmal entflammt, sind vor allem real und müssen gelöst oder, wo das nicht möglich erscheint, rechtlich-zivilisatorisch ›eingehegt‹ werden. Die Entscheidung, dem Geburtenrückgang in einem Land durch eine forcierte Einwanderungspolitik zu begegnen, ist weder populär noch wurde sie durch einen ›rationalen Diskurs‹ herbeigeführt – sie ähnelt erstaunlich politischen Usancen, die bereits den europäische Einigungsprozess in die Sackgasse zu führen halfen: Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. (Jean-Claude Juncker, Der Spiegel vom 27. 12. 1999) Wie bekannt, wird das Geschrei groß, sobald durchdringt, dass es kein Zurück mehr gibt. Es gehört zum Eigentümlichen des herrschenden Demos, dass er, wie einst das Heilige Römische Reich, mit wahrhaft majestätisch zu nennender Verzögerung auf den Plan tritt. Ein Witz wäre es, deshalb zu glauben, er ließe sich mit obrigkeitlichen Mitteln wieder ruhigstellen. Je früher die Parteien der Macht begreifen, dass es an der Zeit ist, die Karten aufzudecken und in fairer Konkurrenz für Politikentwürfe zu werben, die allen Aspekten der großen Herausforderung gerecht werden, statt das Urteilsvermögen der wieder entdeckten Untertanen zu strapazieren und ihre Sprache zu zensieren, desto eher wird es ihnen gelingen –
15.
Ja was denn? Den Staat zu bewahren? Die offene Gesellschaft zu sichern? Die Macht zu behalten? Das ohnehin Geplante zügig weiter zu verfolgen? Den Widerspruch zu ersticken? Die Behörden fit zu machen für die anstehenden Aufgaben? Die Gesellschaft zweckmäßig zu sedieren? Den eigenen Mitgliederstand auf bescheidenem Niveau zu stabilisieren? An Erfolgsszenarien herrscht kein Mangel, an düsteren Ahnungen ebensowenig. Die autoritäre Versuchung, überall spürbar, wird weiter an Kraft gewinnen. Sie wird umso sicherer gewinnen, je leichter es Parteigrößen fällt, sie beim bösen Konkurrenten zu deponieren und dem ›erledigten‹ Souverän einen Artikel zu spendieren.