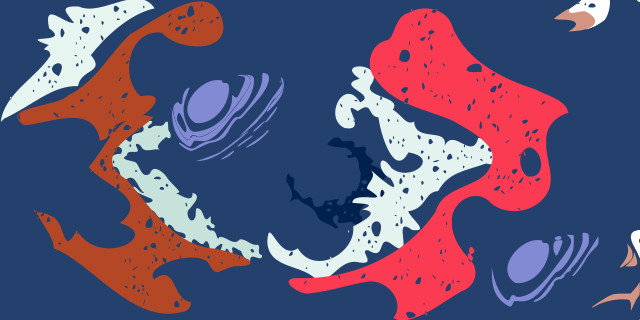von Christoph Jünke
Von türkischen Turbulenzen sprechen politische Kommentatoren und Analysten, von einem sich zuspitzenden Kulturkampf am Bosporus, und was wir gelegentlich über die Nachrichtenticker wahrzunehmen vermögen, klingt schon recht kurios. So erklärte das türkische Verfassungsgericht 2007 die türkische Regierungspartei AKP für verfassungswidrig und scheiterte nur knapp damit, sie deswegen verbieten zu lassen. Die gemäßigt islamische AKP wiederum setzte auf parlamentarischem Wege einen Verfassungszusatz in Kraft, der es türkischen Frauen ›ermöglicht‹, mit Kopftuch zu studieren, was daraufhin von den kemalistischen Verfassungswächtern wiederum für null und nichtig erklärt wurde.
Perry Anderson: Nach Atatürk. Die Türken, ihr Staat und Europa, Berlin (Berenberg Verlag) 2009, 184 Seiten
Wer unter die Oberfläche dieser turbulenten Nachrichten zu schauen gewillt ist – was interessanter Weise kaum passiert, obwohl doch die innenpolitische Entwicklung in der Türkei aufgrund der millionenfachen türkischen Immigrantinnen und Immigranten ein fast schon innenpolitisches Thema der BRD ist –, muss schon zu Spezialveröffentlichungen greifen. Und die werden umso besser, je weiter sie sich weg bewegen von der ideologisch aufgeladenen Angstmache vor den um Einlass in die EU begehrenden nichtchristlichen Türken.
Perry Andersons Buch bietet uns einen solch unaufgeregten, aber überaus erhellenden Zugang. Der in London und Los Angeles lebende Brite irischer Abstammung ist, was man einen angelsächsischen Weltbürger nennen muss. Als marxistischer Historiker und Herausgeber der New Left Review ein Urgestein der internationalen Linken, hat er sich in den letzten drei Jahrzehnten mit seinem unnachahmlichen Stil – einer Mischung aus scharfem, struktur- und sozialgeschichtlich aufgeklärtem Verstand und politisch subtiler Leidenschaft im Gewande britischer Abgeklärtheit – zu einem der weltweit angesehensten politischen Essayisten gemausert, der mit gleicher Gelehrtheit über zeitgenössische politische Intellektuelle von links bis rechts philosophiert wie er über die Geschichte und Politik anderer Länder schreibt, seien dies China oder Israel, Brasilien oder Russland, England oder Frankreich, Italien oder Deutschland.
In seiner intensiven Beschäftigung vor allem mit der historischen und politischen Entwicklung des europäischen Festlandes und der Europäischen Union liegt auch der Kontext seiner hier dokumentierten Auseinandersetzung mit der Türkei. Die drei das Buch bildenden Essays – zwei, die sich der sozialen und politischen Geschichte der Türkei im 20.Jahrhundert widmen, und einer, der sich mit der politischen Entwicklung und Problematik Zyperns auseinandersetzt – sind ursprünglich, wie so viele andere aus Andersons Feder, in der London Review of Books erschienen und werden in der deutschen Buchfassung um einen umfangreichen Anmerkungsapparat ergänzt. Im englischen Original handelt es sich dabei um Teile einer für diesen Sommer angekündigten umfangreichen Studie über die politischen Entwicklungen im Europa nach dem Ende des Kalten Krieges (Perry Anderson: The New-Old World, London 2009).
Die heutige Türkei, so Andersons Einschätzung, ist »in eine kritische Phase eingetreten«. Deren Konturen seien jedoch nur historisch zu erhellen, denn die heutigen Probleme der türkischen Gesellschaft »haben ihren gemeinsamen Ursprung in jenem Integritätsnationalismus, der ohne Bruch, ohne Reue aus den letzten Jahren eines auf Eroberung gegründeten Imperiums hervorging«.
Mit der türkischen Revolution von 1908 beginnt sich der industriell wie gesellschaftlich nachholende Modernisierungsprozess der alten osmanischen Herrschaft zu radikalisieren. Die Jungtürken jedoch, eine ganze Schicht von militärisch organisierten und geprägten Aufklärern, veränderten mit ihrem rabiaten Säkularismus zwar das traditionelle Verhältnis von Gläubigen und Ungläubigen. Das Verhältnis von Herren und Knechten blieb allerdings ebenso wenig verändert wie das ebenso traditionelle Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Trotz aller Radikalität blieben die Revolution und die neue Herrschaftselite eigenartig ambivalent, »weder konsequent modern noch solide traditionalistisch«. Der kulturellen folgte keine soziale Revolution, die alten Gesellschaftsstrukturen blieben weitgehend intakt, die ländliche und kleinstädtische Mehrheit wurde vom kemalistischen Säkularismus nicht erfasst. Letzterer diente vielmehr als Kitt einer städtischen Herrschaftsschicht, die den öffentlich-staatlichen Raum usurpierte und mit militärischer Gewalt und einem ersatzreligiösen Säkularismus gleichsam ›kryptoreligiös‹ verteidigte.
Dass eine solche Ethnisierung des Sozialen seine zwangsläufigen Massenopfer hat, ist eine Erfahrung nicht nur der türkischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Doch das Wüten des türkisch-ethnischen Größenwahns unter christlichen Griechen, Armeniern und Kurden ist schon ein besonderes Kapitel – das Anderson immer wieder sensibel, aber bestimmt darstellt.
Die allenfalls halbierte Emanzipation ließ das Land also »arm, vorwiegend landwirtschaftlich strukturiert« zurück, »es lag eher halberstickt als emanzipiert im festen Griff des Vaters der Türken, wie er [Kemal Atatürk] sich im letzten Lebensabschnitt nennen ließ«. Möglich wurde dies, weil die türkische Elite auf ihrem Weg in die Moderne keinen mächtigen Klassengegner, keine radikale Sozialbewegung zu zerschlagen hatte: »Die meisten Bauern besaßen Land; die Arbeiterschaft war nicht groß; die Intellektuellen fristeten eine Randexistenz; eine Linke trat kaum in Erscheinung. Die Bruchlinien in einer derartigen Gesellschaft – in diesem Stadium noch zuzementiert – hingen eher mit Ethnizität als mit Klassenwidersprüchen zusammen. Unter diesen Voraussetzungen bestand kaum ein Risiko irgendwelcher Erschütterung von unten. Die Eliten konnten ihre Konflikte austragen, ohne befürchten zu müssen, dass sie dabei unkontrollierbare Kräfte freisetzten.«
Die gleichsam andere Seite dieser militaristisch-autoritären Entwicklung war jedoch, gerade weil es die sie herausfordernde soziale und politische Gegenbewegung kaum gegeben hat, die Entfaltung einer langen, auf Parlamentarismus und wechselnde Regierungen setzenden Tradition politischer Freiheit und formaler Demokratie. Die herrschende Elite der kemalistischen und nachkemalistischen Türkei konnte sich ein plurales Mäntelchen umhängen und blieb doch unter sich – hervorragende Voraussetzungen für eine intime Juniorpartnerschaft mit dem US-amerikanischen Welthegemon, zuerst im aufkommenden Kalten Krieg und heute im ›Krieg gegen den Terror‹.
Mit dem Übergreifen der internationalen Revolte Ende der 60er Jahre auch auf die Türkei war die lange Stabilität vorbei. Abermals schlug die Stunde der auf Repression und Militärputsch setzenden Militärs, die sich dabei auch auf jene neofaschistischen Grauen Wölfe stützen konnten, mit denen der Islam wieder zu einem politischen Einflussfaktor wurde. Als man schließlich 1982 zur kontrollierten Demokratie zurückkehrte und gleichzeitig auf eine entschlossene Durchsetzung neoliberaler Wirtschaftspolitik zu setzen begann, kombinierte sich das neoliberale ›Bereichert Euch‹ für die Mittelklassen fortan mit der islamischen Schutzideologie für die breite Masse der Bevölkerung: »Nun war nicht nur der Säkularismus ausgehöhlt, wie ihn die offizielle Doktrin definierte, sondern auch der Etatismus als Wirtschaftsdoktrin.«
Es war also nicht zuletzt die neoliberale Wende der 80er Jahre, die die Hegemonie des türkischen Kemalismus Stück für Stück unterminierte. Und es war die schleichende Islamisierung, die als sozialpolitisches und ideologisches Auffangbecken der neoliberalen Entstaatlichung fungierte – mit dem Ergebnis auch ihres wahlpolitischen Durchbruchs, zuerst in Form der Wohlfahrtspartei, schließlich in der der eher moderaten AKP. Letztere verdankt zwar ihre Mehrheit zu Beginn des neuen Jahrhunderts einem undemokratischen Wahlsystem (Zehn-Prozent-Hürde), erscheint aber als alternativlos und ist nicht zuletzt im gesellschaftlichen Alltag stark verwurzelt. Die alte kemalistische Elite hält zwar noch immer die Justiz und das Militär im festen Griff, aber ansonsten ist sie zunehmend isoliert und durch die mit ihrem Neoliberalismus verbundene Korruption weitgehend desavouiert.
Das sind die historisch gewachsenen Hintergründe des so genannten Kulturkampfes in der Türkei, der sich bei näherem Blick als Machtkampf der Eliten im Angesicht einer auf Schutz und Partizipation drängenden Bevölkerung erweist. Und wenn hiesige regierungsnahe Interpreten den vermeintlich fehlenden politischen und wirtschaftlichen Liberalismus zur gravierenden Lücke der türkischen politischen Landschaft erklären (Heinz Kramer: Türkische Turbulenzen: der andauernde Kulturkampf um die „richtige“ Republik, Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, März 2009, S.17, liegt hier einmal mehr eine interessengeleitete Verwechslung von Liberalismus und Demokratie vor. Die Mehrheit der Türken leidet, das macht Anderson deutlich, nicht am mangelnden Liberalismus, sondern an den traditionell undemokratischen Verhältnissen.
Nicht wenige der heute üblichen Beschwörungen vor einer vermeintlichen Gefahr der Islamisierung sind also ideologischer Ausfluss der in die Enge getriebenen alten türkischen Herrschaftselite und ihrer internationalen Klassenbrüder. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die AKP ihre politischen Mehrheiten vor allem mit ihrem Setzen auf einen Beitritt zur Europäischen Union errungen hat. Nicht der Islam, sondern der Beitritt zur EU ist, so Anderson, die gleichsam magische Formel der Hegemonie der AKP: »Für die breite Bevölkerung (in der viele unter den zwei Millionen Türken in Deutschland Verwandte haben) verkörpert ein Europa, in dem sie sich frei bewegen können, die Hoffnung auf bessere Arbeitsplätze, als man sie zu Hause finden könnte – falls es dort überhaupt welche gibt. Für die großen Unternehmen bedeutet der Beitritt zur EU den Zugang zu üppigeren Kapitalmärkten; für die Unternehmer des Mittelstands geringere Zinssätze; für beide ein stabileres makroökonomisches Umfeld. Für die freien Berufe ist die Anpassung an Europa die Messmarke, die anzeigt, dass die AKP keiner islamistischen Versuchung mehr erliegen wird. Für die liberale Intelligenz würde die EU einen Rückfall in die Militärherrschaft verhindern. Für das Militär würde der lang gehegte kemalistische Traum wahr werden, sich endlich in voller Paradeuniform dem avancierten Westen anzuschließen. Kurz – Europa ist ein gelobtes Land, auf das die durchaus antagonistischen Kräfte der türkischen Gesellschaft aus ganz verschiedenen Gründen ihre sehnsüchtigen Blicke richten können.«
Die Türken sind also schon lange in Europa, ihr Staat jedoch nicht – wie der Verlag Andersons Fazit treffend formuliert. Das hat zum einen mit den massiven, nicht selten ideologischen Widerständen der EU-Mitgliedsstaaten zu tun, aber auch mit realen Problemen wie der Zypern-Frage (einem blinden Fleck auch der linken türkischen Intellektuellen, wie er betont) oder der Frage, wie die türkische Herrschaftselite – Säkulare Kemalisten und islamische AKPler unterscheiden sich hier wenig – mit ihren Minderheiten umgeht. Immerhin ist fast ein Drittel der heutigen türkischen Bevölkerung einer systematischen Diskriminierung in Fragen von Religion und Kultur unterworfen, und auch der gerne als Vergangenheit abgetane türkische Völkermord an den Armeniern ist als »Amalgam aus Verschweigungen und Verrenkungen« durchaus keine ferne Historie, denn »die unerbittliche Weigerung des türkischen Staates, die Tatsache des Massenmordes an den Armeniern auf seinem Territorium anzuerkennen, ist weder anachronistisch noch irrational, sie ist vielmehr eine aktuelle Verteidigung der eigenen Legitimität. … Griechenpogrome 1955/1964; Annexion und Vertreibung von Zyprioten 1974; Ermordung von Alewiten 1978/1993; Unterdrückung der Kurden 1925-2008.« History matters heißt es im Englischen treffend. Und »(e)in integraler Nationalismus, der nie davor zurückschrak, die Armenier auszurotten, die Griechen zu vertreiben, die Kurden zu deportieren und die dissidenten Türken zu foltern, und der immer noch sehr viele Wähler auf seiner Seite hat, ist ein Machtfaktor, den man nicht leicht nehmen sollte«.
Perry Anderson stellt der Türkei also ein alles andere als gutes Zeugnis aus. Heißt dies jedoch, dass sie nicht reif sei für Europa? Nein! Auch wenn er sich vor einer eindeutigen Parteinahme hütet, verdeutlicht er nichts desto trotz, dass die meisten Beweggründe der westeuropäischen Ausgrenzung der Türkei haltlos sind, und dass es vor allem die westliche Diplomatie ist (einmal mehr mit persönlicher Unterstützung grüner humanitärer Interventionisten wie Fischer und Cohn-Bendit), die einen EU-Beitritt der Türkei erfolgreich hinauszögert.
Selbst die türkische Linke – »politisch marginal, aber kulturell zentral« – habe allen Grund zum Beitritt, denn für sie sei »die EU gleichbedeutend mit der Hoffnung auf ein Entrinnen aus dem Doppelkultus Kemals und des Korans und der doppelten Repression. Für die türkischen Armen bietet sie eine Chance auf Arbeitsplätze und elementare soziale Unterstützung, für Kurden und Alewiten die Aussicht auf gewisse Minderheitenrechte. Inwieweit diese Hoffnungen realistisch sind, ist eine andere Frage. Aber sie sind deshalb nicht von der Hand zu weisen.« Fraglich sind hierbei aber nicht nur der Realismus der Hoffnungen, sondern auch die Folgen, die eine über den EU-Beitritt sicherlich voran getriebene Liberalisierung auf die inneren Verhältnisse der Türkei spielen könnte. Das Mehr an politischer Freiheit könnte von einem Verlust an sozialer Kohäsion und von den Langzeitfolgen, die dies für politische Opposition bedeuten kann, begleitet werden. Anderson scheint sich dieses Problems jedoch bewusst zu sein, denn er beendet seine machtvolle Intervention mit einer nachhallenden Warnung: »Die türkischen Träume von einem besseren Leben in Europa muss man achten. Aber die Emanzipation kommt selten von außen.«
* Verlagsinformation hier
Eine stark gekürzte Print-Fassung dieses Beitrags erschien in Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 7/2009.