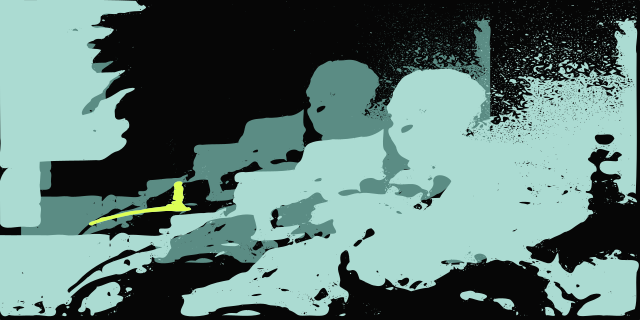von Christoph Jünke
Wahlabstinenz, politische Apathie und Politikerverachtung haben sich im Alltagsleben unserer Gesellschaften nachhaltig verankert. Dass die Bürgerinnen und Bürger demokratiemüde geworden seien, heißt es nicht ganz zu Unrecht. Dass wir es hierbei mit einem Reflex auf die demokratiemüden ökonomischen, politischen und kulturellen Eliten und deren massiv vorangetriebene Demokratieaushöhlung zu tun haben, wird jedoch allzu gern verdrängt. Nicht so in Jacques Rancières Hatred of Democracy (franz. Original: La haine de la démocratie, Paris 2005).
Jacques Rancière: Hatred of Democracy, London (Verso) 2006, 106 Seiten
Der französische Linksphilosoph hat einen (leider noch nicht ins Deutsche übersetzten) ausgesprochen anregenden Essay veröffentlicht, in dem er die »neue Abscheu vor der Demokratie« aufs Korn nimmt. Seine Zielscheibe ist dabei nicht die Bevölkerung als solche. Es sind vielmehr die kulturellen Eliten, die vielen Meinungsmacher und -führer, die sich in der Analyse der vorherrschenden Kulturkrise einig zu sein scheinen, dass all den alltäglichen Auseinandersetzungen um Anerkennung im Kleinen wie im Großen (von den innerfamiliären und innerschulischen Auseinandersetzungen über den Kopftuchstreit und die sozialpolitischen Streiks bis zum Irakkrieg) ein geradezu gefährliches, weil überzogenes Demokratieverständnis zu Grunde liege. Anstatt die Demokratie als begrenztes Mittel für begrenzte Ziele zu betrachten, würden die Individuen der modernen demokratischen Massengesellschaft diese als ein Reich grenzenloser Wünsche reklamieren und drohen auf diesem Wege, die Fundamente der liberal-demokratischen Demokratie zu unterhöhlen. Es ist diese vorherrschende Interpretation, die Rancière als Ideologie fasst und einer umfassenden Kritik unterzieht.
Es gäbe, fasst er die zentrale These dieser neuen Abscheu vor der Demokratie zusammen, »nur eine gute Demokratie, jene die die Katastrophe der demokratischen Kultur unterdrückt« (S.4).1 Ja – so die Meinung dieser Ideologen –, wir bringen Freiheit und Demokratie in den Irak, aber Freiheit und Demokratie sind eben nicht, wie die ewigen Idealisten behaupten, die harmonischen Verhältnisse umfassender demokratischer Selbsttätigkeit, sondern einzig ein institutioneller Rahmen, die demokratische Unordnung zu meistern. Diesem reichlich eingeschränkten, aber vorherrschenden Demokratieverständnis liege, so Ranciére, eine Interpretation zugrunde, wie sie bereits die Trilaterale Kommission seit Anfang der 70er Jahre formuliert habe: Es sei das grenzenlose Bedürfniswachstum demokratischer Bürger, das die Regierungen bedränge, Disziplin und Autorität lockere und die Individuen gegen die Gesellschaft als solche aufbringe. Demokratie als soziale und politische Lebensform sei ein Reich des demokratischen Exzesses, der demokratische Regierungsformen wieder zunichte mache und deswegen unterdrückt werden müsse.
Was in den 70er Jahren vom Establishment begonnen wurde, wurde danach von links aufgegriffen und radikalisiert. Mit den französischen »neuen Philosophen« und den »revisionistischen Historikern« habe Ende der 70er/Anfang der 80er eine Umwertung der Werte begonnen, die neue Akzente setzte. Francois Furet interpretierte die Französische Revolution um, indem er Demokratie und Totalitarismus nicht als Antipoden, sondern als Zwillinge verstand. Die Sünde der Revolution sei nicht ihr Kollektivismus, sondern ihr demokratischer Individualismus gewesen, der zu einer Zerstörung natürlicher und historischer Solidaritäten geführt habe.
Meines Erachtens schlüssig verdeutlicht Rancière im Laufe seiner essayhaften Untersuchung drei entscheidende Aspekte dieser neuen Abscheu vor der Demokratie.
Zum ersten zeigt er auf, welchen spezifischen Beitrag die politische Linke geliefert hat. Mit ihrer »marxistischen« Sicht interpretierte eine bestimmte Linke den in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft vorherrschenden Bourgeois zum allgemeinen demokratischen Menschen um. Wo Marx einen dialektischen Widerspruch zwischen Bourgeois und Citoyen sah,2 setzten bestimmte seiner Schüler ein Gleichheitszeichen und schlossen das demokratische Individuum der politischen Demokratie mit dem individuellen Konsumenten der verallgemeinerten Warengesellschaft analytisch kurz. Wo Marx einen dialektischen Widerspruch zwischen dem Reich kapitalistischer Ungleichheit und Ausbeutung und dem Reich marktwirtschaftlicher Gleichheit ausmachte, lösten bestimmte seiner Schüler das Reich der Ausbeutung in das Reich der Freiheit auf.
So wurde, zweitens, ein an der Zirkulationssphäre des Kapitalismus kleben gebliebener Marxismus zum Steigbügelhalter antidemokratischen Ressentiments, eine bestimmte Tradition politischer Linker zum Bündnispartner einer aus dem Establishment kommenden aristokratischen Kritik des vermeintlich demokratischen Exzesses. Doch schon beim antiken Plato fungierte die Kritik am demokratischen Prinzip als dem universellen Gleichmacher, als dem Verursacher einer unnatürlichen Unordnung zwischen Regierenden und Regierten, Herren und Knechten, Alten und Jungen, Lehrern und Schülern, als Plädoyer für eine erneuerte aristokratische Herrschaft – komme sie nun ökonomisch, politisch oder kulturell daher. Schon die von Parteigängern der antiken Aristokratie formulierte Idee einer republikanischen Ordnung von Institutionen, Gesetzen und moralischen Werten sollte den demokratischen Exzess der Plebejer in Grenzen halten und diente nicht zuletzt dem Herrschaftsanspruch einer sich (vor allem kulturell) aristokratisch fühlenden Intelligenz.
Und dies, so Rancière zum dritten, ist auch der Sinn und Zweck der gegenwärtigen Abscheu vor der Demokratie. Dass sich auch die heutige Intelligenz wieder mehrheitlich antidemokratischen Ressentiments hingebe, sei Produkt der Vorherrschaft des grenzenlosen Kapitals infolge des Zusammenbruchs aller Alternativen – sowohl der des Ostblocks, wie auch derjenigen der (diesem vorausgehenden) westlichen sozialen Bewegungen. Bereits vor dieser weltpolitischen Verschiebung der Kräfteverhältnisse lebten wir, wie er uns erinnert, nicht in einer Demokratie, die diesen Namen verdient. Auch unter den sozialstaatlichen Verhältnissen der Nachkriegszeit gab es eine solide Allianz von Staats- und Wirtschaftsoligarchie, lebten wir in einer konstitutionellen Oligarchie – Rancière spricht von »Staaten oligarchischen Rechts (…), in denen die Macht der Oligarchie durch die doppelte Anerkennung von Volksouveränität und individuellen Freiheiten begrenzt wird« (S.73). Und heute, unter den Bedingungen neoliberaler Grenzenlosigkeit und einer Renaissance der antidemokratischen Prinzipien von Geburt und Verwandtschaft, von Blut, Boden und Religion, komme es zu einer neuen Allianz von Reichtum und Wissenschaft, die sich gegen die vielfältigen Angriffe auf die vermeintlichen Segnungen von Fortschritt und Demokratie abzuschotten trachte. »Wenn der Fortschritt nicht fort schreitet«, fasst Rancière den Zynismus der Intelligenz zusammen, »liegt dies an den Zurückgebliebenen« (S.79). Und er zeigt auf, dass die im Zuge dieser Auseinandersetzung wieder aufgekommene Klage gegen den vermeintlichen »Populismus« ein anti-emanzipativer elitärer Reflex ist, der nur den Wunsch der Oligarchen ausdrückt, fortan ohne das Volk und ohne Politik regieren und herrschen zu können.
Dass es eine natürliche Affinität zwischen beiden, eine soziale Grundlage dieses Positionswechsels von Teilen der einstmals kritischen Intelligenz gibt, verdeutlicht er, wenn er den Bogen zu den ersten beiden Aspekten zieht. Die Tyrannei des herrschenden Konsumismus und die Gesetze der Marktakkumulation werden von diesen neuen Ideologen von Ursachen der Misere zu deren Folgen uminterpretiert, zu Lastern »demokratischer« Individuen, die einzig Waren konsumieren wollen. Diese neuen Ideologen »glauben an den Fortschritt. Sie glaubten an den Fortschritt der Geschichte, als sie vermeintlich zur sozialistischen Weltrevolution führte. Und sie glauben auch heute noch, wo er zum globalen Triumph des Marktes führt, an denselben. Es ist nicht ihre Schuld, wenn die Geschichte falsch gelaufen ist.« (S.86) Und so wie hier die Vorherrschaft der bürgerlich-kapitalistischen Oligarchie zur Demokratie verklärt wird, wird die Vorherrschaft der Wirtschaftsoligarchie zum Auswuchs des Appetits des vermeintlich demokratischen Individuums verklärt, der Kampf gegen die Demokratie zum Kampf gegen den Totalitarismus, dessen Gipfelpunkt die perfide Gleichsetzung von Demokratie und Auschwitz, von Modernität und Ausrottung der Juden sei. Der Genozid als zentraler historischer Bruch- und Bezugspunkt übernimmt hier, so Rancière, dieselbe Funktion, die zuvor die soziale Revolution innehatte.
Die neue Abscheu vor der Demokratie ist also ein elitärer, klassenbedingter Reflex auf die demokratischen Herausforderungen von unten. Sie speist sich aus einer Mischung von aristokratischen und linken Traditionen und erfährt ihre Zuspitzung durch eine sich immer mehr entgrenzende Ökonomie neoliberalen Zuschnitts. Die Fragen an Jacques Rancière beginnen jedoch mit seiner historischen wie politisch-theoretischen Einordnung dieser neuen Abscheu und mit dem, was er dieser Abscheu entgegensetzt.
Rancière betont selbst, dass die neue Abscheu vor der Demokratie nicht wirklich neu sei (schon der Begriff der Demokratie war bekanntlich als Denunziation ins politisch-intellektuelle Spiel gebracht worden) und es deswegen darauf ankomme, ihren neuartigen Charakter genauer zu bestimmen. Neu ist für ihn, dass sie sich aus zwei Quellen speise, aus zwei historischen Formen der Demokratiekritik, aus der aristokratischen und der marxistischen Demokratiekritik. Hier jedoch wird er ungenau. Denn so wie die aristokratische Kritik genauer betrachtet eine Kritik aus den Traditionen konservativer Kulturkritik ist (aristokratisch nur im kulturellen, nicht im sozialgeschichtlichen Sinne), speist sich deren linke Variante nicht aus dem Marxismus, bzw. nur insoweit sie (in linksradikaler Tendenz) mit diesem gebrochen hat. Rancière scheint dies nicht so zu sehen, denn er macht den Marxismus als ganzen verantwortlich. Sein diesbezüglicher Vorwurf jedoch, dass auch die Marxsche Tradition den demokratischen Gehalt, die demokratische Idee zur reinen Illusion stempelt, dass sie zwischen Wesen und Erscheinung trennt, um die demokratischen Erscheinungsformen auf das bürgerlich-kapitalistische Wesen zu reduzieren, ist nicht mehr als eine altbekannte, grobe Verzerrung des Marxschen Denkens, ein unstatthafter Kurzschluss von linker Praxis auf linke Theorie. Marx reduzierte weder das Wesen auf die Erscheinung noch die Erscheinung auf das Wesen, zeigte stattdessen gerade deren engen, dialektischen Zusammenhang auf. Marx kritisierte die Halbheiten der bürgerlich-politischen Emanzipation nicht, um sie zu verwerfen. Ganz im Gegenteil rief er dazu auf, sich nicht mit diesen Halbheiten zufrieden zu geben und die Emanzipation weiter zu treiben. Die Marxsche Kritik zerpflückte die imaginären Blumen an der Kette »nicht damit der Mensch die phantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche«.3 Und Rosa Luxemburg übersetzte dies in die Politik der Demokratie, als sie gegen Lenin und Trotzki darauf hinwies, dass die Kritik der formalen Demokratie nicht dazu dient, »diese zu verwerfen, sondern um die Arbeiterklasse dazu anzustacheln, sich nicht mit der süßen Schale [der formalen Gleichheit und Freiheit] zu begnügen, vielmehr die politische Macht zu erobern, um sie mit neuem sozialem Inhalt zu füllen«.4 Rancière ist hier offenbar den vulgärmaterialistischen Mythen seiner eigenen (maoistischen) Jugend zum Opfer gefallen und verwechselt bestimmte »marxistische« Strömungen, d.h. einen historisch leider recht wirkmächtigen Vulgärmarxismus, mit dem Marxschen Denken. Das hat Konsequenzen auch für seine eigene Position.
Er bürstet den alten Plato gegen den Strich und betont, dass schon in der Antike die eigentliche demokratische Idee mit der Abwesenheit jedes »natürlichen« oder gesellschaftlich-konstitutionellen Rechtsanspruches beginne, mit der Überwindung jeder Vorherrschaft von Verwandtschaft, Geburtsrecht, Alter oder biologischer oder kultureller Konstitution. Erst mit der antiken Erfindung des zufälligen Loswurfes bei der Auswahl der Ämter, so Rancière treffend, werden die herrschaftlichen Traditionen ohne Ansehen der Person gebrochen. Erst dadurch werde Politik mehr als eine Herrschaftstechnik, erst dadurch zeige sich der der Politik ur-eigene Grund. Politik beginne mit der Transformation natürlicher oder sozialer Rechtsansprüche, also erst, wenn die Menschen über Vaterschaft und Mutterschaft, über Alter, Reichtum, Macht und Wissenschaft hinausgehen. »Demokratie bedeutet zuallererst dies: eine anarchische ›Regierung‹, die auf nichts anderem basiert als der Abwesenheit jedes Rechtsanspruches zur Regierung.« (S.41) In gewissem Sinne stimme es also, dass die Demokratie ein universeller Gleichmacher ist. Nur sei dies eben ihr unhintergehbares emanzipatives Erbe. Politische Macht, so Rancière, ist »die Macht derjenigen, die keinen natürlichen Grund haben, über jene zu herrschen, die keinen natürlichen Grund haben, beherrscht zu werden« (S.47). Die neue Abscheu vor der Demokratie sei deswegen nicht nur zutiefst undemokratisch, sondern mehr noch geradezu anti-politisch.
Auf eindrucksvolle Weise verdeutlicht er damit die radikal-demokratische Ur-Idee einer menschlichen Freiheit und Gleichheit, die nur ganzheitlich gefasst werden kann und nicht als lediglich politische, ökonomische oder kulturelle. Und insofern hat er auch Recht, zu betonen, dass Demokratie eigentlich keine bestimmte Gesellschafts- oder Regierungsform ist, dass sie nicht mit einer spezifischen politisch-juristischen Form identifiziert werden könne und ihr Kampfterrain jene Öffentlichkeit ist, in der gegen alle Formen der Privatisierung gestritten und den politischen, ökonomischen und kulturellen Oligarchen das Monopol öffentlichen Lebens und die Macht des Reichtums streitig gemacht wird.
Das kann allerdings nicht bedeuten, dass Demokratie gegen ihre Formen indifferent sein kann. Auch wenn er dies sogar selbst einräumt (S.54), verfolgt Rancière diese Spur leider nicht weiter und gerät mit seinem Ansatz stattdessen auf einseitiges Gleis. Die von ihm treffend herausgearbeitete demokratische Ur-Idee bleibt nämlich trotz ihrer wirkmächtigen Logik »nur« eine solch an sich abstrakte Zielidee, die ihre geschichtliche Konkretisierung am historischen Material immer wieder suchen muss. Historisch entfaltet hat sie sich durch die geschichtlichen Kämpfe von Klassen, Schichten und Individuen hindurch, ist ihr dabei mal näher und mal ferner gekommen. Rancière dagegen löst diese konkrete Historie im Nebel einer abstrakten demokratischen Logik auf, die kurioserweise gerade jenem individualistischen Bild eines von der realen Geschichte losgelösten »demokratischen Menschen« frönt, das er an anderen kritisiert.
Kollektive Subjekte radikaler Demokratisierung kann und will er nicht erkennen und den Traum einer mit der Demokratie verbundenen neuen Gesellschaft, gemeint ist hier natürlich »der« Sozialismus, hält er für ausgeträumt. Abermals verdeutlicht er hier seine grobe Verzerrung des Marxschen Denkens, wenn er behauptet, es sei getragen von einer Vision, in der »die kapitalistischen Formen von Produktion und Austausch die materiellen Bedingungen für eine egalitäre Gesellschaft und ihre weltweite Expansion bilden« (S.96).
Marx’ Rede von den emanzipativen Produktivkräften, die die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft selbst gebäre, bezog sich jedoch weniger, wie das hartnäckige Vorurteil meint, auf die rein ökonomisch-materiellen, gleichsam quantitativen Produktivkräfte. Sie bezog sich vielmehr auf die politisch-kulturellen, auf die qualitativen Produktivkräfte, die sich nicht nur, aber eben auch nicht zuletzt in der sozialen und politischen Bewegung einer systemtranszendierenden Arbeiterbewegung niederschlagen, und die die neue kapitalistische Gesellschaftsform immer wieder neu zu erzeugen gezwungen ist. Hier findet sich auch der Grund dafür, dass man, im direkten Kontrast zu Rancières Behauptung, gerade mit den kapitalistischen Formen von Produktion und Austausch brechen wollte. Beides jedoch ist im Produktivkraftfetischismus des klassischen sozialdemokratischen Marxismus wie des Stalinismus (nicht zufällig) verloren gegangen. Obwohl sich Rancière in seinen jungen Jahren, unter dem Einfluss von Louis Althusser wie als späterer Kritiker desselben, aus diesem Fetischismus zu lösen versuchte, scheint ihm dies nicht ganz geglückt. Der heutige Postmarxist schüttet hier das Kind mit dem Bade aus – als ob es »westlichen Marxismus« und »Neue Linke« (im weitesten Sinne der Begriffe) nicht gegeben hätte.
So kommt es schließlich auch, dass er sogar meint, der von Hardt und Negri aufgebrachten Vision einer radikaldemokratischen Multitude – einer Vision, die im Übrigen der seinigen recht nahe zu kommen scheint – vorwerfen zu können und zu müssen, dass selbst diese, gleichsam postmarxistische und postkommunistische Konzeption noch viel zu sehr in der alten marxistisch-kommunistischen Tradition materieller Vorbedingungen radikaler Demokratie gefangen sei. »Zu verstehen, was Demokratie bedeutet, heißt, auf solchen Glauben zu verzichten«, schreibt er: »Die von einem Herrschaftssystem produzierte kollektive Intelligenz ist immer nur die Intelligenz dieses Systems. Die ungleiche Gesellschaft trägt keinerlei gleiche Gesellschaft in ihrem Mutterleib. Die egalitäre Gesellschaft ist vielmehr immer nur der Satz an egalitären Beziehungen, die sich hier und jetzt durch singuläre und anfechtbare Akte auffinden lassen.« (S.96)
Demokratische Politik wird so nicht nur losgelöst von der Geschichte und den von ihnen vorgegebenen ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen. Sie wird auf diesem Wege zum ganz Anderen, zum unvermittelten Sprung zwischen Gestern, Heute und Morgen – zum unvermittelten Akt einer gestaltlosen Masse. Dass alle Intelligenz immer nur die Intelligenz des Systems und die Klassengesellschaft keine Mittel und Formen einer über sie hinausweisenden Egalität aufweise, das ist aber nicht nur derselbe linksradikale Nonsens, der auch dem von ihm selbst so beklagten Positionswechsel linker Intellektueller in den 70er und 80er Jahren zu Grunde lag. In solch einem dichotomischen Entweder-Oder wird auch das theoretische wie praktische Problem des »unreinen« Überganges von dem einen gesellschaftlichen Zustand zum anderen suspendiert, also gerade das, woran die Linke bisher gescheitert ist.
Demokratie ist nicht reduzierbar auf ihre reine, abstrakte Idee. Sie ist ebenso Zielidee wie Mittel, soziale Bewegung wie politische Institution, individuell wie kollektiv, Kontinuität wie Bruch. Die sozialistische Linke hat die Demokratie (im Prinzip zu Recht) immer zuerst als eine soziale Bewegung gefasst, die einen konkreten historischen Gegner mit konkreten historischen Mitteln zu überwinden trachtet. Fragen demokratischer Formen und Institutionen sind demgegenüber, mindestens in entscheidenden Momenten, ignoriert, heruntergespielt oder gar denunziert worden,5 nicht zuletzt indem man einer Metaphysik der Klasse und des Klassenkampfs gefrönt hat. Jacques Rancière hat sich von solcher Metaphysik verabschiedet und, wie gesagt, das Kinde mit dem Bade ausgeschüttet. Seiner Jugend treu geblieben ist er dagegen in der Verdrängung von Fragen demokratischer Formen und Institutionen. Politik und Demokratie sind ihm einzig die Kraft einer Negation. Suspendiert wird so das politische Problem der Vermittlung und des Übergangs – in meinen Augen der Kern des Politischen.
Rancière und seine Anhänger aus der »autonomen Linken« können dem widersprechen, da er einen anderen, einen zu diesem Ansatz und zu dieser Strömung passenden Begriff von Politik entwickelt hat.6 Auch wenn mir der jedoch mehr als Teil des Problems erscheint denn als Teil der Lösung, so befinden wir uns damit bereits in einer Diskussion über die Wege zum Ziel einer Wiederaneignung radikaldemokratischer, emanzipativ-sozialistischer Traditionen, die Rancière in seiner herausragenden Kritik der herrschenden Demokratiemüdigkeit eröffnet hat.
Die Print-Fassung dieses Beitrages erschien in der Züricher Zeitschrift Widerspruch, Heft 55, Dezember 2008.
1 Da ich die Zitate (aus der englischen Fassung) selbst übersetzt habe, gebe ich hier die Seitenzahlen mit an. Den von Rancière im Original benutzten Begriff des ›Hasses‹ möchte ich im Folgenden jedoch etwas nüchterner und meines Erachtens analytisch treffender mit dem Begriff der ›Abscheu‹ übersetzen.
2 Vgl. dazu Leo Kofler: Vergeistigung von Herrschaft. Staat, Gesellschaft und Elite zwischen Humanismus und Nihilismus (1960), Band 2, Frankfurt/M. 1991 (Kapitel: »Liberalismus und Demokratie oder der Citoyen als Bourgeois«), sowie ders.: »Liberalismus und Demokratie«, in ders.: Zur Dialektik der Kultur, Frankfurt/M. 1972.
3 »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung«, in: MEW 1, S.379.
4 »Zur russischen Revolution«, in: LGW 4, S.363.
5 Vgl. dazu Christoph Jünke: Der lange Schatten des Stalinismus. Sozialismus und Demokratie gestern und heute, Köln 2007 (Kapitel 8: „Luciano Canforas Demokratieverständnis“).
6 Vgl. dazu Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt/M. 2002, sowie ders.: Zehn Thesen zur Politik, Zürich-Berlin 2008.