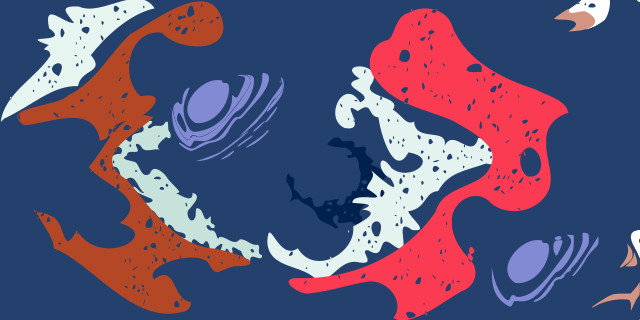von Herbert Ammon
Mit Geopolitik, den geographischen und historisch-kulturellen Bedingungen politischen Handelns, hat sich die ›kritische Linke‹ im 20. Jahrhundert kaum je befasst. Als ideologisch aufgeladenes Synonym für den Imperialismus, dereinst im Weltkriegsjahr 1916 (veröffentlicht 1917) von Lenin »gemeinverständlich« definiert »als höchstes Stadium des Kapitalismus«, war der Begriff verpönt. Selbst nach dem Mauerfall im Epochenjahr 1989, der viele alte Gewissheiten zum Einsturz brachte und die geopolitischen Realitäten erneut vor Augen rückte, machten die meisten ›Linken‹ einen Bogen um ›Geopolitik‹.
Tobias ten Brink: Geopolitik. Geschichte und Gegenwart kapitalistischer Staatenkonkurrenz. Mit einem Vorwort von Bob Jessop, Münster 2008: Westfälisches Dampfboot, 307 S.
Mit einigen Erwartungen geht man daher an das Buch von Tobias ten Brink, entstanden als politikwissenschaftliche Dissertation unter dem Frankfurter Marxisten Joachim Hirsch: Wie fließen physikalische Geographie, Insel- oder Binnenlage eines Landes, Ressourcen und Bevölkerungspotential, Agrar- und Industriestrukturen samt technischem Entwicklungsstand, last but not least, kulturelle ›Produktivkräfte‹ in eine marxistische, ›materialistische‹ Analyse ein? Heißt es nicht schon bei den ›linken‹ Kirchenvätern (die selbst den Begriff ›links‹ nirgends verwendeten) in der Deutschen Ideologie (1844): »Wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Die Geschichte kann von zwei Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur und die Geschichte der Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen; solange Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und Geschichte der Menschen gegenseitig.«
Die geographischen Naturgegebenheiten von Staaten als grundlegende materielle Faktoren des politischen Handelns waren das große Thema der ›Geopolitik‹, von Friedrich Ratzel und Halford Mackinder über Rudolf Kjellén und Karl Haushofer bis zu Francis Spykman. Eine Studie mit dem Titel Geopolitik: Geschichte und Gegenwart kapitalistischer Staatenkonkurrenz sollte zumindest einleitend auf die Doktrinen dieser im 20. Jahrhundert überaus einflussreichen Protagonisten Bezug nehmen, und sei es, um die marxistische Analyse von ›imperialistischer‹ Apologetik abzugrenzen. Der Autor erwähnt die »deutsche geopolitische Schule um Karl Haushofer« und deren fatale Applikation im Nationalsozialismus nur in der allerersten Fußnote. (S.16). Von den einschlägigen Namen »im angelsächsischen Raum« (ibid.), wo der Begriff derzeit eine Renaissance erlebt, kommt außer Zbigniew Brzezinski, Vertreter eines geopolitisch ausgerichteten ›Realismus‹, akademischer Lehrer von Madeleine Albright, Akteur im inneren Machtzirkel Washingtons seit Jimmy Carter, in ten Brinks Buch keiner vor. In der über dreißigseitigen Literaturliste sind zwar eine Unzahl marxistischer (die ganze Galerie von größeren und minderen Geistern, von Marx, Rosa Luxemburg, Lenin und Antonio Gramsci über Paul Sweezy, Ernest Mandel, Nico Poulantzas, Cornelius Castoriadis bis zu Elmar Altvater und Frank Deppe u.a.) sowie nichtmarxistischer Autoren (von Werner Sombart über Joseph Schumpeter bis zu Hannah Arendt und Herfried Münkler) aufgeführt, doch keiner der ›Klassiker‹ der Geopolitik.
Ziel der Dissertation ist die Analyse der »geopolitischen bzw. imperialistischen Phänomene« ( u.a. S. 17, 164). In der fehlenden begrifflichen Differenzierung (»bzw.«) ließe sich bereits das grundlegende theoretische Manko der an Theorie überreichen Arbeit fixieren. Worauf zielt das Thema? Der Autor erklärt einleitend, er ziehe »an vielen Stellen« den Begriff >Geopolitik dem des Imperialismus vor, weil letzterer, mit direkter Gewaltanwendung assoziiert, »die vielschichtigen Konfliktformen unterhalb eines offenen Gewaltaustrags« nicht erfasse. »Weil der Begriff des Imperialismus bzw. des imperialistischen Phänomens besonders während des Kalten Krieges zu einem hochgradig besetzten, politischen Kampfbegriff wurde«, soll »eine kurze Definition...den wissenschaftlichen Gebrauch des Begriffs bzw. des synonym verwendeten Begriffs Geopolitik (Hervorh. H.A.) ermöglichen und vor theoretischen Einseitigkeiten schützen. Das Phänomen des kapitalistischen Imperialismus kann hier vorläufig als eine offene oder latente Gewaltpraxis von kapitalistischen Einzelstaaten zur Verteidigung, Befestigung bzw. Steigerung ihrer Macht vor dem Hintergrund weltweiter ökonomischer Abhängigkeiten und politischer Fragmentierung verstanden werden.« (S. 17).
Eine solche Definition »imperialistischer bzw. geopolitischer Phänomene« schließt nicht-kapitalistische Staaten anscheinend von der Analyse aus. Das ist kein Zufall. Denn in der von der Frankfurter Schule geprägten Sicht der Dinge gibt es um nichts anderes als die von destruktiver kapitalistischer Dynamik durchtränkte Moderne. In ten Brinks Analyse der »imperialistischen bzw. geopolitischen« Phänomene geht es daher um nichts geringeres als die Aufdeckung sämtlicher Wirkungsmechanismen des Kapitalismus. Es geht nicht um eine historisch fundierte Analyse des ökonomisch und geographisch determinierten imperialistischen Ausgreifens von dazu befähigten Mächten, auch nicht allgemein um die geopolitischen Handlungsbedingungen und -strategien von Staaten (›kapitalistischer Staaten‹). Damit wird der Begriff ›Geopolitik‹ inhaltlich und heuristisch von vornherein entwertet. Denn was taugt ein ›neuer‹ Begriff ›Geopolitik‹ als begrifflich abgeschwächtes Synonym von ›Imperialismus‹? Wie tritt durch den ›global‹ ausgeweiteten Begriff des ›Kapitalismus‹ und der ›kapitalistischen Staatenkonkurrenz‹ die Spezifik der Begriffe ›Imperialismus‹/ ›Geopolitik‹ hervor?
Zur Kritik am Ansatz: Historisch-geographisch durchaus unterschiedlich situierte Kleinstaaten wie Luxemburg oder Singapur, Bastionen (finanz-)kapitalistischer Akkumulation, scheinen zu imperialistischer Politik kaum geeignet, der obigen Definition nach indes dazu prädestiniert. Weiter: Ist die 1945 einsetzende, durch blutigen Krieg (1950-1953) verfestigte Teilung Koreas der Theorie nach als ›imperialistisches‹, in nuce ›kapitalistisches‹ Epiphänomen zu betrachten oder nicht viel mehr als klassisches ›geopolitisches‹ Phänomen, verursacht durch den Zusammenstoß der Mächte und Ideologien nach dem II. Weltkrieg auf der geostrategisch bedeutsamen Halbinsel in Ostasien? Wie anders als klassisch ›geopolitisch‹ – oder schlicht historisch – ist die wenige Jahre nach dem Siege Maos über Chiang Kaishek augenfällige Verfeindung der sozialistischen ›Bruderstaaten‹ Sowjetunion und VR China zu erklären? Schließlich: Wie ist heute, knapp zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums, das Verhältnis der geschwächten Großmacht Russland und des alten ›Reiches der Mitte‹ zu beurteilen? Täglich strömen derzeit an die 5000 Chinesen über die offene Grenze im Fernen Osten. Es handelt sich um faktische Geopolitik, weitab von jeglicher ›kapitalistischer Staatenkonkurrenz‹, es sei denn, man wolle das Phänomen der illegalen Einwanderung den Strategien der zum Kapitalismus konvertierten chinesischen Kommunisten zuschreiben.
Entgegen dem Titel des Buches liegen historisch-politische Analysen weithin außerhalb des Betrachtungsfeldes. Zwei Drittel des Buches sind der reinen Theorie gewidmet, kompiliert aus einer Überfülle an Literatur. Selbst wo er eine historische Analyse der »Phasen der Staatlichkeit«, sowie des Ost-West-Konflikts (unter dem Rubrum »kapitalistische Staatenkonkurrenz«) vornimmt, bewegt sich ten Brink vornehmlich auf dem Felde der Theorie. Erst im dritten Teil der Arbeit (»Marktliberaler Etatismus: Gegenwärtige geopolitische Phänomene«) nimmt er relevante Fragestellungen auf, so zum Charakter der USA (»Anspruch und Realität des amerikanischen Imperiums«), zur »konfliktbeladenen Partnerschaft« EU-USA sowie zum möglichen neuen Großkonflikt China-USA.
Von den letztgenannten Themen abgesehen, geht es nicht um konkrete Fragestellungen, sondern um den Kapitalismus, genauer: um die sich »geopolitisch bzw. imperialistisch« manifestierende Dynamik jener Wirtschaftsform (»Produktionsweise«), deren Konflikthaltigkeit in marxistischer Terminologie gemeinhin mit den »Widersprüchen des Kapitalismus« benannt wird. In Zeiten der ›Globalisierung‹ und der ›Finanzkrise‹, verursacht von den global beschleunigten Strömen spekulativen Kapitals, gewinnt marxistische Kapitalismuskritik erneut an Plausibilität. Nur: Wie werden die von derlei »Widersprüchen« erschütterten Staaten zu ›geopolitischen‹ Akteuren? Wie ›vermittelt‹ eine noch so differenzierte marxistische Analyse die »Verwertungszwänge des Kapitals« sowie die »kapitalistische Staatenkonkurrenz« mit aktuellen, hochbrisanten Konflikten, mit dem permanent kriegerisch aufflammenden Israel-Palästina-Konflikt oder dem Krieg am Hindukusch, wo nach den Worten des einstigen Verteidigungsministers Peter Struck (SPD) »Deutschland verteidigt wird«?
Ten Brinks theoretische Grundlegung erfolgt anhand der für Dissertationen typischen umfangreichen Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur, mit den hinsichtlich der Phänomene ›Macht‹, ›Machtpolitik‹, ›Imperialismus‹ konkurrierenden Denkschulen. Von der ältesten Imperialismustheorie des liberalen John A. Hobson über die alt- und neomarxistischen Theorien von Lenin über Kautsky bis Sweezy et al. sowie die in der derzeitigen Globalisierungskritik einflussreichen Theorie des universalen ›Empire‹ von Antonio Negri / Michael Hardt (2002) gelangt er zu dem »Neo-Weberianer« Michael Mann, über den von Hans J. Morgenthau in den USA etablierten Realismus zum ›offensiven‹ Realismus (»Neorealismus«) John Mearsheimers. Die Kritik an den bekannten marxistischen Imperialismuskonzepten, den »Ein-Punkt-Definitionen« des Kapitalismus (S.52) ist überzeugend. Doch auch die anderen Theorien leiden nach ten Brink an »Unterkomplexität«.
Das als »geopolitisch bzw. imperialistisch« definierte, von »verselbständigten institutionalisierten Handlungszwängen« durchdrungene kapitalistische Weltsystem soll auf drei Ebenen analysiert werden: 1) Anhand der »konstitutiven Strukturmerkmale«. Diese sind gut marxistisch mit mehrwertheckender Lohnarbeit, Konkurrenz und »Geldverhältnissen« benannt, ergänzt durch »Vielstaatlichkeit sowie den Weltwirtschaftszusammenhang«. Es geht um die »Verbindung von Ausbeutung und Konkurrenz«, um die Verknüpfung innergesellschaftlicher, »vertikaler« Klassenkonflikte mit »›horizontalen‹ Spaltungen der Konkurrenzbeziehungen« (S.55). 2) Das »Phänomen des kapitalistischen Imperialismus [soll] historisiert werden«, indem die genannten Strukturmerkmale zu »diversen historischen Phasen der kapitalistischen Entwicklung in Beziehung« gesetzt und 3) anhand von »spezifischen historischen Konstellationen« analysiert werden (S. 48). Dabei möchte der Autor die »politikwissenschaftliche Engführung in der Disziplin der Internationalen Beziehungen« vermeiden. Es »werden Ansätze aus weiteren Disziplinen – der Soziologie, der Geographie (sic!) sowie der Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften einbezogen.« (Ibid.) Ein anspruchsvolles Projekt.
Was ist danach Neues zum Thema ›Geopolitik‹ zu erfahren? Der ›Imperialismus‹ als allseitiges Expansions- und Destruktionsmoment ist dem »Kapitalismus als global fragmentierten System in Raum und Zeit« (so ein Untertitel im umfangreichen Theorieteil II) inhärent. Er manifestiert sich im Kontext der Internationalen Beziehungen, die wiederum in einem »multirelationalen Geflecht« stattfinden. Für sie gilt: »Nicht intendierte bzw. antizipierte, d.h. auch gewaltförmige Folgen des Handelns sind aufgrund der Komplexität der internationalen Ebene geradezu unausweichlich.« (S.86) Um dies zu wissen, genügt, fern jeder Theorie, der Blick in die Tageszeitung.
Was die Lektüre zur Anstrengung macht, ist nicht allein das Übermaß an ›Theorie‹. Die Theorie selbst bleibt in einigen Punkten unscharf. Die Rolle des Staates gegenüber der kapitalistischen Wirtschaft sowie der Begriff der zu ›Imperialismus‹ tendierenden »Staatenkonkurrenz“« werden keineswegs plausibel. Wie ist das Verhältnis von Staat und Wirtschaft/Gesellschaft, von ›Überbau‹ und ›Basis‹ zu bestimmen? Der Autor behilft sich mit dem bei Marxisten beliebten Winkelzug: »An bestimmten...Punkten [kapitalistischer Vergesellschaftung] ist die relative Autonomie des Politischen ein Erfordernis eines entwickelten Kapitalverhältnisses...« (57f.) Das ›Politische‹ besteht im Handeln des gegenüber dem rein ›Ökonomischen‹ eigenständigen Staates. Gleichzeitig erscheint der Staat, genauer, der bürgerliche Rechtsstaat wiederum als Agentur des Kapitalismus, denn: »Wirtschaftliche Prozesse verlangen in der Realität die Konsolidierung von Rechten und Freiheiten sowie eine Reihe an Methoden und Mitteln, diese zu garantieren.« (S. 58).
Weiter unten wird das theoretische Problem mit einem Zitat von Joachim Hirsch gelöst, der das »Interesse des Staates an sich selbst« betont. »Der Staat der bestehenden Gesellschaft ist also aus strukturellen Gründen ›kapitalistisch‹, und nicht allein deshalb, weil er direkten Einflüssen des Kapitals unterworfen ist« (zit. S. 75) – eine klassische Tautologie als Antwort auf das Problem. Warum sollte der Staat funktional als »dritte Partei« zur Regelung der kapitalistischen Austauschverhältnisse (S. 71) – überhaupt existieren? Am Ende wird der Staat (die konkurrierenden »kapitalistischen Einzelstaaten«) nach seinen rechtlichen, ökonomischen und soziokulturellen Aufgaben bestimmt. Er fungiert als Kassenverwalter (bezüglich der »Geldverhältnisse«), als Vermittler zwischen den »Kapitalfraktionen«, Weltmarktkonkurrent, Krisenmanager und sozialintegrativer Umverteilungsapparat in den »imaginierten Gemeinschaften«, womit die von Benedict Anderson et al. ›dekonstruierten‹ neuzeitlichen Nationen gemeint sind.
Kritik fordert die historische Fundierung der Theorie (»Es existiert nicht der kapitalistische Imperialismus, er muss immer in seiner historischen Spezifizität analysiert werden«, S. 17) heraus. Sie erscheint nur dann plausibel, wenn man unter der Prämisse des Globalkapitalismus a) der groben Linie der kapitalistischen Entwicklungslogik und der drei »Weltordnungsphasen« folgt: 1870-1945 (»klassischer Imperialismus«); 1945-1972 (»Supermachts-Imperialismus«); ab 1989 (»neue Weltunordnung«) und b) über Fehlurteile und Fehler im Historisch-Faktischen hinwegsieht. Wo von der Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Wirtschaft die Rede ist, hätte man den Verweis auf Nikolai Kondratieff (»Die langen Wellen der Konjunktur«, 1926) erwartet, der die ›langen Wellen‹ mit den Innovationsschüben des industriellen Kapitalismus korrelierte. Allein, diese Krisentheorie findet keine Erwähnung.
Die Unterscheidung zwischen vorkapitalististischer (›feudaler‹) und kapitalistischer Produktionsweise mag den neuzeitlichen Geschichtsprozess durchaus erhellen. Doch sollte dabei die Realgeschichte nicht strapaziert werden. Was nur späte Jünger Trotzkis oder eben Frankfurter Neomarxisten überzeugen kann, ist die These, auch Stalins im Zeichen der Fünfjahrespläne voran getriebene Industrialisierung sei nur eine Variante des seinerzeitigen ›Staatskapitalismus‹ gewesen. Dass es zwischen der auf Staatsverschuldung gegründeten Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten und dem New Deal unter F. D. Roosevelt gewisse Parallelen gab, ist unter Historikern bekannt, ebenso, dass erst die Rüstungsökonomie ab 1938 die USA (»Rüstungskeynesianismus«) aus der Depression herausführte. Gleichwohl: Der Satz »Aus einer globalen Perspektive stellt der Trend hin zu staatskapitalistischen Volkswirtschaften ein zentrales Phasenmerkmal des weltweiten Kapitalismus ab den 1930ern dar« (S. 205), ist allein von der Chronologie her abwegig. Der 1929 verkündete erste Fünfjahresplan Stalins wurde bereits 1928 ausgearbeitet, ohne irgendeinen Bezug zu der nach dem ›Schwarzen Freitag‹ (13. Oktober 1928) eklatierenden Weltwirtschaftskrise.
Die geläufige These, die in millionenfachen Tod mündende Kollektivierung sei, aus theoretischer Distanz betrachtet, nichts anderes als die im Kapitalismus übliche Freisetzung von auf dem Lande gebundenener Arbeitskraft für die staatskapitalistische Industrie, leuchtet stets nur auf den ersten Blick ein. Gewiss, Stalin bezahlte mit Getreideexporten für den Import von Maschinen, er zielte auf die Rationalisierung der von ›Kulaken‹ und eigennützigen Substistenzbauern betriebenen Landwirtschaft zugunsten der Schwer- und Rüstungsindustrie. Dennoch, von allem Terror und Millionenopfern abgesehen, bleibt die simple Frage: Was war daran ›kapitalistisch‹, sofern darunter etwas anderes als die bloße, im Gulag und in den Betrieben vielfach kontraproduktive, Ausbeutung von Arbeitskraft zu verstehen ist? Die Marxsche Mehrwerttheorie ist an den Markt gebunden. Wo kein Markt, da kein zu realisierender Mehrwert, wo keine Konkurrenz, kein kostensteigerndes konstantes Kapital (sprich Maschinen und Rohstoffe) und kein variables Kapital (sprich ausbeutungsfähige Arbeitskräfte). Entsprechend taugt die Marxsche Formel vom tendenziellen Fall der Profitrate nur für den kapitalistischen Markt, genauer: für die Wirtschaftsform, in der Kapital eingesetzt wird, um auf dem Markt Gewinn zu erzielen. Von einem Markt – außer dem Schwarzmarkt – kann in staatlich-bürokratisch gelenkten Ökonomien keine Rede sein. Der von Castoriadis und anderen etablierte Begriff des »bürokratischen Staatskapitalismus« (S. 204) für Stalins Sowjetunion klingt zwar überzeugend, verdeckt jedoch den theoretischen Widerspruch. Es handelte sich um rabiate ›Akkumulation‹, nicht um marktorientierte Kapitalbildung.
Dem Verlangen nach reiner Theorie entspringt die Vorstellung, der von Stalin vor und nach 1945 betriebene Expansionismus sei seinem Wesen nach ›kapitalistisch‹ inspiriert gewesen. Die Schachzüge und Gewaltakte des sowjetischen Diktators, die nach herkömmlich ›imperialistischem‹ Muster und im Sinne russischer Geopolitik verliefen, werden nicht diskutiert. Schließlich wird der Ost-West-Konflikt, der Kalte Krieg zwischen den Siegermächten des II. Weltkriegs, in die theoretisch korrekte Perspektive gerückt: Die »sozialistischen« (Anführungszeichen von ten Brink) Staaten »waren denselben Imperativen unterworfen« wie der ›kapitalistische‹ Westen. »Der Ost-West-Konflikt kann demgemäß als Auseinandersetzung zweier kapitalistischer Weltordnungsmodelle konzeptualisiert werden.« (S. 202). Als Kronzeuge für die These vom kapitalistischen Charakter des Sowjetimperialismus dient Theodor Adorno mit einem Zitat zum ›Spätkapitalismus‹: »Selbst die Imperialismustheorien sind mit dem erzwungenen Verzicht der großen Mächte auf Kolonien nicht bloß veraltet. Der Prozess, den sie meinten, setzt sich fort in dem Antagonismus der beiden monströsen Machtblöcke.« (Zit. S. 202). Der Satz ist unsinnig, auch wenn er vom Meister der Frankfurter Schule stammt.
An anderer Stelle behauptet ten Brink, »der Unterschied zwischen Privateigentum und Staatseigentum« sei »aus globaler Perspektive nur als ein quantitativer« zu verstehen. In aller Unschuld deckt er dabei eine missglückte Begriffslogik auf: Wenn sich Staatseigentum unter »demokratischer Kontrolle« befände, stünde die Sache anders, denn ein »grundlegendes Strukturelement der kapitalistischen Klassengesellschaft« fiele weg. (S.183) . Eben nicht, das Problem verlagerte sich nur: Wie hätte die ›demokratische Kontrolle‹ (jenseits der hierzulande praktizierten gewerkschaftlichen Mitbestimmung) auszusehen? Welche Art von ›klassenlosem‹ demos bildete die neue Basis der Demokratie? Und würden Staaten mit ›Wirtschaftsdemokratie‹, wie sie etwa vor 1933 und nach 1945 Theoretikern der Sozialdemokratie (Fritz Naphtali, Erik Nölting, Viktor Agartz) vorschwebte, in globalem Maßstab in eine Ära des ewigen Friedens eintreten?
Ärgerlich, nicht nur für Historiker, wird es bei der sparsamen Exemplifikation der von ten Brink verfolgten »komplexen Theorie«. »In den spätfeudalen Kriegen verlor der Verlierer im Falle einer Kriegsniederlage häufig sein Territorium und wurde kolonisiert, in den geopolitischen Konflikten und Kriegen des Kapitalismus ist dies nicht die Regel.« (S. 44, Fn.12). Die Außenpolitik Woodrow Wilsons, die der Autor, Werner Link folgend, nicht nur von hehren friedensethischen Zielen inspiriert sieht, fand »in den 1920ern« statt. (S.237, Fn. 15). Wilson schied 1921 aus dem Amt. Abwegig ist die von einem anderen Autor entliehene These, die Aufstellung der Pershing II-Raketen – die sog. NATO- ›Nachrüstung‹ wurde anno 1978/1979 von Bundeskanzler Schmidt gefordert – habe dem Zweck gedient, »die sowjetisch-deutsche Entspannung zu hintertreiben« und die Bundesrepublik wieder ins Glied zu drücken. (S. 243, Fn. 20). Gedanklich schlichter noch wird das Phänomen des ›geopolitisch‹ bedeutsamen, ›kapitalistisch-imperialistisch‹ verursachten Phänomens des Staatsverfalls demonstriert. Nach Exempeln wie Sierra Leone, Somalia, Kongo folgt der Satz: »Der Zerfall der DDR und der Anschluss an die BRD ist ein Beispiel jüngeren Datums aus Europa.« (S. 124, Fn. 89).
Unvermittelt wird gegen Ende des Buches dann doch auf Formeln der ›älteren‹ Geopolitik zurückgegriffen. Im Abschnitt über »die Geopolitik der Sowjetunion«, deren kapitalistisch-imperialistischer Charakter der »Degeneration« der ursprünglich besseren Ziele der russischen Revolution zugeschrieben wird (S. 203, Fn.203), heißt es in Bezug auf Afghanistan: »Eine geopolitische Intervention war es schließlich, die den Niedergang des Sowjetstaats beschleunigte... Der missglückte Feldzug wurde zum ›Vietnam‹ der Sowjetunion.« (S.215) Richtig. Nur hätte man zu Afghanistan, dem historischen Erbfall aus Zeiten des klassischen Imperialismus – Friedrich Engels schrieb schon 1857 über das »tapfere, zähe und freiheitsliebende Volk der Afghanen« – aus marxistischer Feder gerne etwas mehr erfahren. Waren etwa die in den 1970er Jahren am Traditionalismus der Stämme am Khaiber-Pass gescheiterten ›linken‹ Revolutionäre – eine ›Revolution von oben‹ von unter sich verfeindeten Progressisten – am Ende nichts als Irrläufer des globalen Kapitalismus?
Orthodox ›geopolitisch‹ wird die Argumentation, wo es um die Folgen der Implosion des Sowjetimperiums, um »Anspruch und Realität des amerikanischen Imperiums«, um die künftigen ›Konkurrenzen‹ zwischen den USA, Russland und China geht. Hier taucht plötzlich der Begriff ›Eurasian Continental Rim‹ auf, die Rede ist vom »Great Game«. (S. 242f). Wie passen derlei Begriffe, entliehen von zeitgenössischen Autoren (nicht von Spykman bzw. Mackinder), in die bis dahin verfolgte ›linke‹ Perspektive?
Die Arbeit ist nicht ohne Meriten. Zu Recht wendet sich ten Brink – in Widerspruch zur eher pessimistischen These getragen von der Hoffnung auf eine bessere, demokratische Weltordnung – gegen die Vorstellung, demokratische Staaten seien von Natur aus friedfertiger als andere. Er zweifelt am liberalen »Kosmopolitismus« des Soziologen Ulrich Beck ebenso wie an Jürgen Habermas´ Credo vom Sieg der Vernunft in einer demokratischen Weltgesellschaft.
All das kann die Unschärfen und Schwächen, insbesondere die dürftige empirische Evidenz des Buches nicht aufwiegen. Zu beanstanden sind nicht nur die der reinen Theorie geschuldeten Fehler und Abstrusitäten. Die zum Nachweis der politikwissenschaftlichen Versiertheit betriebene Begriffshuberei (Glokalisierung; makro-regionale Mächte mit weniger großer Wirkungsmacht wie Italien, Russland (??), Brasilien oder Indien‹; subimperialistische Mächte wie Südkorea, Türkei, Israel, Ägypten oder Südafrika) sowie die hermetische marxistische Terminologie seien nachgesehen. Nicht gilt dies für popsprachliche Entgleisungen (»der Hype des Antikommunismus in den 1950ern«, S. 236), die in einer wissenschaftlichen Abhandlung nichts zu suchen haben. Kritik verdient vor allem der Ansatz selbst. Wo die politik-theoretische Globalanalyse auf die Erklärung des Ganzen zielt, ohne am factum brutum die Evidenz der Theorie zu belegen, wird alles, aber eben auch nichts erklärt. So bleibt der Ertrag des Buches, anders Bob Jessop in seinem rühmenden Vorwort meint, fragwürdig.
Nicht zufällig erfolgt gegen Ende des Buches eine weitere Berufung auf Horkheimer/Adorno, auf die Väter des Begriffs vom umfassenden ›Verblendungszusammenhang‹ des Kapitalismus. Sie bezeichneten den Imperialismus als »die furchtbarste Gestalt der Ratio« (S. 269). Zum Schluss (S. 271) zitiert ten Brink noch den ›neulinken‹ amerikanischen Historiker Gabriel Kolko: »Die Welt ist heute komplexer und gefährlicher, als sie es noch im Kalten Krieg war. Die Dezentralisierung militärischer und politischer Macht und der verhärtete Ehrgeiz der USA, praktisch unendlich viele Staaten führen zu wollen, sind eine hochexplosive Mischung.« Mit derlei Einsichten zur ›Geopolitik‹ , inklusive moderater Kritik an den USA – teils Hauptakteur des allseits betriebenen ›Imperialismus‹, teils geschwächte Hegemonialmacht im geopolitischen Raum – bleibt der Autor innerhalb der scientific community auf der sicheren Seite.