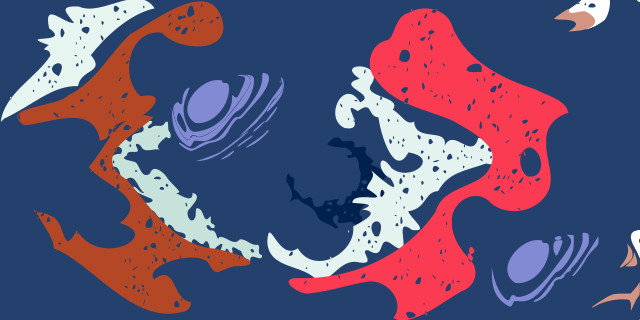von Lutz Götze
Japans Krise
Die große Rückrufaktion des Toyotakonzerns im Frühjahr 2010 wegen schadhafter Bremsen und Gaspedale hat ein grundsätzliches Problem offenbart: Wie können gesellschaftliche Normen im Zeitalter der Globalisierung bewahrt werden, ohne dass schwer wiegende finanzielle Nachteile oder gar eine Identitätskrise einer ganzen Gesellschaft drohen? Denn Toyota ist Japan: der Konzern verkörpert nicht nur wegen seiner immensen Dimension als weltgrößter Autohersteller den Inselstaat Nippon schlechthin.
Wenn Toyota in die Krise gerät, wird Japan in seinem Selbstwertgefühl empfindlich gestört; der weltweite Ansehensverlust der Automarke stürzte Japan in schwere Zweifel an seiner Überlegenheit nicht nur im pazifischasiatischen Raum. Der Enkel des Firmengründers ließ sich vor einen Ausschuss des amerikanischen Kongresses zitieren und gelobte Besserung. Angehörige von Opfern der Unfälle mit Toyota-Fahrzeugen in den USA sparten vor der Kamera nicht mit Tränen. Freilich hatte diese Szene etwas zutiefst Heuchlerisches: Über die Zivilopfer amerikanischer Verbrechen im Irak und in Afghanistan werden in Washington keine Tränen vergossen!
Westliche so genannte Wirtschaftsexperten werden nicht müde zu behaupten, die Wurzel des Toyota-Problems liege in der verkrusteten und bürokratischen Struktur der japanischen Produktion und Verwaltung: Das Bemühen um Zustimmung aller am Prozess Beteiligten, als Ergebnis der konfuzianischen Grundregel vom Vermeiden jeglichen Gesichtsverlustes, sei nicht nur zeitaufwändig, sondern vor allem produktionsschädigend. Wer so produziere – dies die nahezu einhellige Meinung aller in Asien zu vernehmenden Stimmen –, müsse notwendigerweise verlieren: Toyota sei ein schlagender Beweis!
Doch könnte es nicht auch gerade umgekehrt verlaufen sein: Japan – und auch hier liegt Toyota vorn – hat sich in relativ kurzer Zeit auf fordistische Fertigungsverfahren umgestellt, produziert in frappierendem Tempo Markenartikel und steht an der Spitze der Weltwirtschaft. Doch Japans Gesellschaft ist dieser rasanten Entwicklung nicht gefolgt: Teilweise brutal ausgetragene Proteste von Jugendlichen, wachsende Arbeitslosigkeit und Altersarmut zeugen von tiefen sozialen Problemen. Die Industrie- und Bankenvorstände haben sich längst vom japanischen Common Sense verabschiedet und denken in westlichen Kategorien: schneller produzieren, Mehrwert erwirtschaften, Aktionäre und Management mit Dividenden und Boni zufrieden stellen, also: egoistisch agieren. Nicht nur bei Toyota verlassen Mitarbeiter auf eigenen Wunsch die Firma, in der Großvater und Vater ein Leben lang arbeiteten. Die Gesellschaft ist im Umbruch; mehr Flexibilität und Reichtum bei den ›Ellenbogentypen‹, mehr Armut und Vereinsamung bei den Zögerlichen und Traditionsverpflichteten. Japan übernimmt westliche Denk- und Produktionsstrukturen und gibt gleichzeitig über Jahrhunderte gewachsene Verhaltensweisen und Normen auf. Der Geschwindigkeit werden Solidität und Qualitätsbewusstsein geopfert: Toyota beweist es.
Ob Japan zu alten Werten zurückkehrt, ist zu bezweifeln. Vielmehr hat es den Anschein, dass der rasante Deformationsprozess nicht mehr aufzuhalten ist. Zu wessen Nutzen? Japans Gesellschaft droht ein Schisma.
Poppers These und der Positivismus-Streit
So bietet sich die Szene in Thailands Hauptstadt Bangkok dar, die täglich im Autostau erstickt. Aus abendländischer Sicht aber stellt sich nach einigen Wochen Lehre an der hiesigen Ramkhamhaeng-Universität die Frage, wie Erkenntnisstreben einerseits und das Vermeiden von Kritik ob etwaigen Gesichtsverlustes andererseits zusammenpassen. Wir haben von Ernst Popper gelernt, dass Erkenntnisse und Wissen ausschließlich oder zumindest vorrangig über die Falsifikation anwüchsen, also die begründete Kritik an herrschenden Lehrmeinungen und das Entwickeln einer Gegenposition. Affirmation hingegen, so Popper, führe zu Schulterschluss, Unterordnung unter die Mehrheitsmeinung und schließlich zum Gedankenterror.
Zwar schaffe ich es im Kolleg immer wieder, die Studenten zur Reaktion herauszufordern, aber häufig ist es mühselig und im Grunde ihrem Normenverständnis widersprechend. Der Professor vorn hat eben Recht, wir notieren seine Worte und geben sie wortgetreu wieder, so das Credo.
Dass diese Haltung – dies keineswegs nur in Parenthese – zum Gedankendiebstahl führt, ist hinlänglich bekannt. In Asien, keineswegs nur in China, ist das Plagiat hoffähig; man hat dort kein wirkliches Verhältnis zum geistigen Eigentum: in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft! Kopie und geistiges Schöpfertum freilich schließen einander aus. Wie aber sollen bei dieser Grundhaltung Forschung gedeihen und Wissen vertieft und gemehrt werden?
Doch muss zunächst gefragt werden, ob das Popper'sche Modell im interkulturellen Dialog seine Validität bislang nachgewiesen hat. Entwickelt wurde es in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Europa, als die Bekämpfung des Faschismus und später der Aufbau demokratischer Staaten und ihre Stabilisierung gegen neue Diktaturen unter dem Führungsanspruch der Sowjetunion – wozu auch der Kalte Krieg gehört – auf der Tagesordnung standen. Entwickelt wurde es von Popper aber vor allem am Beispiel der Naturwissenschaften. Beide Aspekte schufen die Grundlage einer Trennung zwischen Wahr und Falsch, die vergleichsweise einfach war. Negation der Nazidiktatur und des Stalinismus einerseits und die Entscheidung über die Gültigkeit von Axiomen in den Naturwissenschaften andererseits ließen kaum Spielraum zu für Variabilitäten, Ja-aber-Entscheidungen oder Sowohl-als-auch-Schlüsse. Recht haben könnten nicht beide Seiten eines Konfliktes, so Popper.
Die Übertragbarkeit solchen dualistischen Denkens auf die Sozial- und Geisteswissenschaften ist zumindest fraglich und ihre Berechtigung im Grunde nie ernsthaft nachgewiesen worden. Im Positivismusstreit der Popper-Schule – maßgeblich von seinem Mannheimer Schüler Hans Albert vorgetragen – und der Frankfurter Kritischen Theorie um Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und seinen Schüler Jürgen Habermas wurde dieses Problem unmittelbar evident. Die Frankfurter Schule, zumal Habermas, verwies auf die jeweilige Kulturspezifik von Erklärungsmodellen gesellschaftlicher Normen, die zunächst formuliert und erst dann, im möglichst herrschaftsfreien Diskurs, einer Lösung oder zumindest friedlichen Duldung zwischen den Kulturen zugeführt werden müssten. Das erste Gebot solchen interkulturellen Bestrebens sei Toleranz. Norbert Elias spricht später von Deutungsmustern.
Ich füge hinzu, dass – ganz im Sinne des Goethe-Spruchs aus den Maximen und Reflexionen – Duldung nur der Anfang sein kann, weil sie im Grunde eine Beleidigung des Schwächeren ist. Sie muss deshalb im Dialog der Kulturen zur Anerkennung führen.
Wir fügen freilich zweitens hinzu, dass diese Anerkennung nicht grenzenlos und wertneutral sein kann. Toleranz gegenüber Intoleranz darf es nicht geben; Terrorismus jeglicher Art ist verdammenswert, wo und wie immer er begründet wird. Der Maßstab für alle Entscheidungen ist die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.
Habermas unterstreicht also das hermeneutische Bemühen um die Deutung von Texten unterschiedlicher Werteordnungen. Dazu gehören religiöse wie säkulare Texte. Auf der Metaebene tauchen dann gelegentlich, beim genauen Studium, Gemeinsamkeiten auf. So ist dem Kantischen Imperativ – also der Allgemeingültigkeit und Normativität individuellen Handelns – die Lehre Buddhas eng verwandt, genauer, bereits mehr als 2000 Jahre früher formuliert. Auch der Buddha fordert von seinen Schülern und Anhängern, verantwortlich zu handeln und die Ergebnisse ihres Tuns nicht irgendwelchen Göttern zuzuweisen, sondern selbst dafür einzustehen. Mein Karma – das Ergebnis meines Denkens und Handelns – prägt nach meinem Ableben ein nächstes Lebewesen: Ich bin dafür verantwortlich, wie dieses sein Leben gestaltet.
Solche durchaus vorhandenen Gemeinsamkeiten freilich vermögen letztlich wenig Hilfe zu geben in unserer Auseinandersetzung um den rechten Weg zur Erkenntnis. Ist es die rationale, an der Aufklärung geschulte, Erkenntnisförderung oder aber die über die Meditation führende innere Erkenntnis – gipfelnd in der Erleuchtung –, die der Buddhismus lehrt? Und wie sind davon Natur- und Geisteswissenschaften betroffen? Gelten für diese die Regeln von Vernunft und Verstand, für jene aber eher die Deutung, das Sowohl-als-Auch, das Verhandelbare?
Das wäre zu simpel, zu sehr schablonenhaftes Denken. Deutungsmuster sind allenthalben erforderlich und ebenso der herrschaftsfreie Diskurs. Doch wie soll er gelingen in Gesellschaften wie der buddhistischen, die auf der weltlichen Seite die Ordnungsprinzipien des Konfuzius verinnerlicht hat und nicht einen Jota davon abweicht? Kritik an herrschenden Normen oder Zuständen ist unüblich, weil gesichtsverletzend, oder gar gefährlich und existenzbedrohend. China, Myanmar, Nordkorea sind beredtes Zeugnis. Die Wenigen aber, die wider den Stachel löcken – wie Li Xiaobo in China –, landen im Regelfall im Gefängnis oder werden klammheimlich liquidiert, in China freilich immer noch in Massenerschießungsritualen. Also passen sich die jungen Leute früh an, dienen den Mächtigen und stärken dergestalt das Regime, so in den Diktaturen. In den pseudo-demokratischen Staaten wie Thailand hingegen degeneriert die junge Generation zur Spaß-Gesellschaft: Man amüsiert sich zu Tode, was vor allem heißt: Fotografieren und Telefonieren bis zum Exzess, Diskothek, Drogen, Autos, Strände, Geplapper. Man hängt herum!
Für ernsthafte Studien sind das äußerst negative Voraussetzungen: Das Lesen ungekürzter Texte oder gar Romane an der Universität ist unüblich, ja: verpönt. Man will leichten Sinnes und Schrittes an das Ziel gelangen. Deshalb sind Bachelor- und Masterprogramme hier genau richtig: verschultes Kurzzeitstudium, alles wird ›benutzerfreundlich‹ verpackt, Daten werden vom Lehrenden vermittelt und von den Lernenden auswendig gelernt, um bei den allfälligen (und unentwegt eingeforderten) Prüfungen präsentiert und anschließend vergessen zu werden, weil Inhalte – in welchem Beruf auch immer – ohnehin nicht gebraucht werden. In Asien wird obendrein – weil ›flexibel‹ – der Job im Leben häufig gewechselt, wenn erforderlich, gewünscht oder möglich.
Meine Vorlesungen und Seminare zeigen genau dieses Dilemma: Ich muss ungeheuer viel vortragen und dann nachdrücklich Mitarbeit einfordern, ansonsten ist ein Dialog nicht möglich. Das hat nur am Rande mit sprachlichen Problemen zu tun, weit mehr mit Lehr- und Lerntraditionen, mit Mentalitätsunterschieden und konfuzianischen Regelsystemen.
Orient und Okzident
Ein Blick vom fernen Osten hinüber zum Abendland: Europa geht nicht erst seit Beginn dieses Jahrtausends genau den Weg in diese, also die verkehrte Richtung. Erkenntnis durch lebenslanges Studium wird dergestalt Zug um Zug verhindert. Am Ende bleibt ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden können, wie es im Galilei heißt: vielseitig verwendbar, profitorientiert, oberflächlich, ungebildet und nicht kreativ, ohne Konzepte oder gar Visionen. Die nachfolgenden Generationen in Europa werden sich, wenn die Menschen des ›alten Kontinents‹ es jetzt nicht verhindern, so entwickeln, wie Chinesen, Malaien, Thais, Burmesen und Vietnamesen bereits heute in ihrer Mehrzahl sind: unkreativ, aber mehrwertorientiert, kopierfreudig und plagiatssüchtig, vergnügungsbesessen und medienvernarrt. Denn sie können nichts wirklich Eigenständiges denken und entwickeln, weil sie die Mühen der Grundlagenforschung scheuen und ihnen obendrein häufig die Disziplin zum kontinuierlichen Arbeiten fehlt. Der Druck des Kollektivs und der Zwang der Gesichtswahrung tun ein Übriges. Dergleichen mag halbwegs brauchbare Autos und Brücken neben jeder Menge an Wohlstandsmüll hervorbringen, zu neuen Denkansätzen reicht es freilich mitnichten.
Solche allein dem Konsum, der Korruption und dem Wohlverhalten – das auf Opportunismus und Feigheit beruht – gewidmeten Systeme sind noch allemal in der Geschichte gescheitert: Rom war längst verludert, bevor Germanen und Osmanen ihm den Todesstoß versetzten; das Osmanische Reich seinerseits siechte schon lange vor dem 1. Weltkrieg dahin; das Kaiserreich der Chin währte lange und ging doch an seiner inneren Verfaultheit zugrunde. Dem jetzigen Großreich China droht in Kürze ein gigantischer Einbruch, mehrfach schlimmer als im ›neuen Babylon‹ Dubai: überhitzte Konjunktur, Korruption, gigantische Inflation, Auseinanderklaffen von Arm und Reich, Imperialismus und Unterdrückung von ethnischen und liberalen Minderheiten prägen bereits heute die Wirklichkeit des einstigen Reiches der Mitte. Dabei gilt: Wenn China wackelt, stürzt nicht nur der gesamte ost- und südostasiatische Kontinent! Davor zittern die wenigen Nachdenklichen in Bangkok und Hongkong; die Masse hingegen amüsiert sich zu Tode, wie gehabt.
Europa, zumindest sein protestantischer Teil, brauchte im Grunde vor diesen Tiger-Staaten nicht bange zu sein, wenn es sich auf seine traditionellen Werte besänne: hohe Intelligenz, Verantwortungsbereitschaft, Qualität, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit und ein Leben nicht über die Verhältnisse.
Doch der Zug rast seit geraumer Zeit in die genau entgegengesetzte Richtung, wie nicht nur das erschreckende Beispiel Griechenlands zeigt: ein gigantischer Kulturverfall von der einstmals vollkommenen Polis des Platon und Perikles zum verwahrlosten Bittsteller in Brüssel und Berlin. Island, Portugal, Irland, Spanien, Italien und Ungarn sind im Grunde nicht besser. Daher gibt es keine vernünftige Alternative zur Rückkehr zu traditionellen Werten des besseren Europa: Diese müssen in Elternhaus, Schule, Universität lebenslang vermittelt werden. Die Universitäten als europäische Institution und in ihrer besonderen Prägung durch Wilhelm von Humboldt zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielen dabei eine herausragende Rolle. Sie verstanden sich seit mindestens zweihundert Jahren als Ort der wissenschaftlichen Reflexion, die nicht oder zumindest nicht unmittelbar praktischen Zwecken, zumal der Taylorisierung, unterworfen wurde. Freiheit von Lehre und Forschung bedeutete über Generationen hinweg Freiheit von teleologischen Kurzschlüssen. Heute hat es freilich eher den Anschein, dass zahlreiche Bildungspolitiker und auch Wissenschaftler das von der Humboldt'schen Forderung missverstehen: nicht als ein Grundsätzliches im Sinne des Genitivus subjectivus (»Lehre und Forschung sind frei!«), sondern ein dissipatives: Kein Wissenschaftler braucht sich darum zu kümmern, weil er frei davon ist (»Wir brauchen Lehre und Forschung nicht«).
Die einstmals zweckfreie Grundlagenforschung verkommt in diesem Prozess zur Indienststellung unter Produktionsziele, zur Verzweckung. Gegeben hat es solche Entwicklungen sicherlich schon früher: Man denke an die jedes Erkenntnisinteresse verleugnende Etappe des Behaviorismus, man denke ebenso an kontext- und damit bedeutungsfreie Linguistiken wie etwa die Generative Transformationsgrammatik.
Freilich hatten diese Entwicklungen vergleichsweise geringen Einfluss auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen.
Dies ist heute unter dem Diktat globaler Medienausbreitung und -nutzung grundlegend anders. Sie bestimmen Alltag und Wissenschaft entscheidend. Was sie abbilden, gerät zur Norm. Was sie nicht darzustellen vermögen, verfällt oder wird im Zeitgeist sublimiert. Der grandiose Erfolg des Internets und der Zwitscherforen beruht ja gerade auf einer Entwicklung, die das kritische und profunde Denken letalisiert und Augenblickswahrheiten, dauernde Medienberieselung und Amüsier-Besessenheit an seine Stelle gesetzt hat. Dabei ist unbestritten, dass der weltweite Zugang zum Internet für viele Menschen, zumal in Diktaturen wie China und Burma, zunächst einen immensen Kenntnisgewinn darstellt, bis die Menschen auch dort begreifen, welche Gefahr der elektronische Müll in Wahrheit darstellt, da eigenständiges und kritisches Denken auf dem Altar des Konsumwahns geopfert werden. Ein der Billigkonkurrenz Asiens hinterher eilendes Europa kann auf den Weltmärkten nur verlieren; sein Gegenentwurf muss daher auf der höchsten Qualität und Verlässlichkeit basieren und auf demokratischen Grundwerten aufgebaut sein. Toyotas Rückrufaktion und weltweiter Ansehensverlust sind ein Menetekel: Dergleichen dürfen sich BMW oder Siemens nicht leisten!
Doch es geht nur sekundär um Absatzmärkte und Exportraten: Im Kern geht es um eine geistige Auseinandersetzung. Gelingt es Deutschland und vergleichbaren Staaten, also dem Kerneuropa, zur protestantischen Ethik im Weber'schen Sinne zurückzukehren, haben sie eine gute Überlebenschance; gelingt ihnen das nicht, werden sie im Strudel des Tanzes um das Goldene Kalb untergehen.
Internetsucht
Eine jüngst veröffentlichte Untersuchung über die Nutzung neuer Medien – zumal des Internet – in China hat erschreckende Ergebnisse gezeitigt. Unter Jugendlichen herrsche eine gravierende Internetsucht, »die Zahl der Betroffenen wird auf 10 Millionen geschätzt« (Siemons 2010: 31). Die Eltern, die Kommunistische Partei Chinas und zahlreiche Wissenschaftler warnen vor einer Entwicklung, deren Symptome bereits heute bei den Süchtigen deutlich erkennbar sind: In der leistungs- und erfolgsorientierten chinesischen Gesellschaft melden sich seit bereits geraumer Zeit immer mehr Jugendliche ab, verweigern sich dem Leistungsdruck und versinken in der virtuellen Welt des Internet: eine »Apathie, die bis zum völligen Verstummen reicht, die Vernachlässigung des Schulbesuchs, das tagelange Verschwinden oder auch das Gegenteil, ein wochenlanges Verbarrikadieren im eigenen Zimmer. Manche Kinder sollen sogar den Toilettenbesuch eingestellt haben und dazu übergegangen sein, Windeln zu tragen.
Das Internet im Allgemeinen und Computerspiele im Besonderen stehen im Verdacht, auf bestimmte junge Leute einen derartigen Sog auszuüben, dass sie für das normale Leben und dessen Leistungsanforderungen untauglich werden – ein gerade für chinesische Eltern, die gewohnt sind, ihre ganze Existenz auf das berufliche Fortkommen der Kinder auszurichten, zutiefst beunruhigender, ja, unheimlicher Vorgang.« (Siemons 2010: 31)
Das Phänomen der Internetsucht ist ein weltweit zu beobachtendes Problem, doch nirgendwo ist es derartig dramatisch wie in Asien und dort keineswegs nur in China. Japan war der Vorläufer, doch das Reich der Mitte steht allein wegen seiner inkommensurablen Größe heute an der Spitze dieser Entwicklung; Thailand folgt auf dem Fuße.
Kulturindustrie
Ist dieses Phänomen nun Ausdruck des Protestes gegen eine seelenlose Leistungsgesellschaft, der Emotionen und Empathie abhanden gekommen sind, oder – wie zahlreiche Kritiker behaupten – lediglich das Versagen einer unbedeutenden Minderheit unter der heranwachsenden Generation, die pflichtvergessen sei. Oder ist es – drittens – die neueste, freilich dramatische, Entwicklung dessen, was Theodor W. Adorno vor Jahrzehnten bereits an mehreren Stellen als Kulturindustrie gebrandmarkt hat:
»Aber der Widerspruch zwischen Bildung und Gesellschaft resultiert nicht einfach in Unbildung alten Stils, der bäuerlichen. Eher sind die ländlichen Bezirke heute Brutstätten der Halbbildung. Dort ist, nicht zuletzt dank der Massenmedien Radio und Fernsehen, die vorbürgerliche, wesentlich an der traditionellen Bildung haftende Vorstellungswelt jäh zerbrochen. Sie wird verdrängt vom Geist der Kulturindustrie; das Apriori des eigentlich bürgerlichen Bildungsbegriffs jedoch, die Autonomie, hat keine Zeit gehabt, sich zu formieren. Das Bewußtsein geht unmittelbar von einer Heteronomie zur anderen über; anstelle der Autorität der Bibel tritt die des Sportplatzes, des Fernsehens und der ›Wahren Geschichten‹, die auf den Anspruch des Buchstäblichen, der Tatsächlichkeit diesseits der produktiven Einbindungskraft sich stützt.« (Adorno 1981: 72)
Ersetze ich nun Bibel durch das Kommunistische Manifest und die Schriften Mao Tse Tungs sowie bäuerliche Unbildung durch wesentliche Teile der jungen Generation in China und in der Welt, so können wir Adornos Beschreibung auf die Gegenwart ohne Wenn und Aber übertragen. Seine luzide Analyse der sich ubiquitär ausbreitenden Halbbildung ist, im Zeitalter des Internet und der hemmungslosen und unkritischen Anbetung der neuen Medien, vollkommen stimmig. Bei Adorno heißt es:
»Aber die Bedingungen der materiellen Produktion selber dulden schwerlich jenen Typus von Erfahrung, auf den die traditionellen Bildungsinhalte abgestimmt waren, die vorweg kommuniziert werden. Damit geht es der Bildung selbst, trotz aller Förderung, an den Lebensnerv. Vielerorten steht sie, als unpraktische Umständlichkeit und eitle Widerspenstigkeit, dem Fortkommen bereits im Wege: wer noch weiß, was ein Gedicht ist, wird schwerlich eine gute Stellung als Texter finden.
Im Klima der Halbbildung überdauern die wahrhaft verdinglichten Sachgehalte von Bildung auf Kosten ihres Wahrheitsgehalts und ihrer lebendigen Beziehung zu lebendigen Subjekten. (...) Halbbildung ist der vom Fetischcharakter der Ware ergriffene Geist ... Die Attitüde, in der Halbbildung und kollektiver Narzißmus sich vereinen, ist die des Verfügens, Mitredens, als Fachmann Sich-Gebärdens, Dazu-Gehörens. Die Phänomenologie der Sprache in der verwalteten Welt ..., zumal die ›Sprache des Angebers‹, ist geradezu die Ontologie von Halbbildung, und die sprachlichen Monstrositäten, die er interpretierte, sind die Male der mißlungenen Identifikation mit dem objektiven Geist an diesem. Um überhaupt noch den Anforderungen zu genügen, welche Gesellschaft an die Menschen richtet, reduziert Bildung sich auf die Kennmarke gesellschaftlicher Immanenz und Integriertheit und wird unverhohlen sich selber ein Tauschbares, Verwertbares.« (Adorno 1981: 75 ff.)
Genau diese, von Adorno prognostizierte, Entwicklung erleben wir heute, freilich in dramatischer Weise. Statt eines Erkenntnisstrebens und einer umfassenden Bildung, wie sie einstmals besonders eindringlich Wilhelm von Humboldt eingefordert hatte (von Humboldt: 1964), erleben wir den alltäglichen Wahnsinn des Fernsehgeschwätzes, der Talkshows und der ›Events‹ einerseits sowie des Geplappers der Massen andererseits, die sich nicht scheuen, auch die letzte Banalität oder Intimität in Chat-Foren oder Ähnlichem auszubreiten. Statt Bildung und Diskretion beherrschen Halbbildung und hemmungslose Preisgabe des Intimen (›sich-Outen‹) die Szene.
Dies ist nun freilich kein auf Asien beschränktes Phänomen: In Europa erleben wir es, zeitversetzt und gelegentlich noch etwas subtiler, in ähnlicher Weise. Kulturspezifische Besonderheiten treten dabei immer häufiger in den Hintergrund.
Dies hat keineswegs nur mit einer Gesellschaft und zumal einer heranwachsenden Generation zu tun, die theoretische Reflexionen scheut und nicht-berufsorientiertes Lernen als akademische Spielerei diffamiert, die vermeintlich lebensfern sei und zu nichts Anständigem tauge.
Geistes- und Naturwissenschaften
Dies liegt vor allem an den Wissenschaften selbst, zumal den Geisteswissenschaften im eigentlichen Sinne, die die von Descartes beklagenswerterweise ins Leben gerufene Unterscheidung der res extensa und res cogitans aufgegriffen und allenfalls resignativ oder negativ darauf geantwortet haben. Die Geisteswissenschaften seien dazu da, die durch neue Techniken und unkritischen Forschungsdrang geschaffenen gesellschaftlichen und Umweltprobleme – jüngster Präzedenzfall ist die Erdölkatastrophe im Golf von Mexiko – im Nachhinein zu erklären, mit Sinn zu erfüllen und vor dem Schlimmsten zu warnen, so Odo Marquard vor Jahren. Zuletzt warnte Martha C. Nussbaum, Philosophin an der Universität von Chicago, vor den Folgen des Bildungsabbaus. Zur Rettung der Geisteswissenschaften formulierte sie in der Princeton University Press 2010:
»In ihrem Streben nach Vorteilen im internationalen Wettbewerb verzichten die Staaten und ihre Bildungseinrichtungen zunehmend auf die Fertigkeiten, die es braucht, um die Demokratie lebendig zu erhalten. Wenn sich die Entwicklung fortsetzt, werden die Staaten überall auf der Welt bald Generationen von nützlichen, fügsamen, technisch gut ausgebildeten Maschinen hervorbringen, anstelle von selbstbewussten Bürgern, die selber denken und das Hergebrachte kritisieren sowie das Leiden und die Leistungen anderer Menschen verstehen können.« (Times Literary Supplement, 30. April)
Die Geisteswissenschaften sind bei diesem Prozess des Widerstands gegen die Verdinglichung der Welt nicht nur unverzichtbar, sondern müssen wieder eine führende Rolle im gesellschaftlichen Diskurs über die Zukunft der Menschheit gewinnen. Das Gegenteil ist derzeit der Fall: Das Ranking der Jiaotong-Universität Shanghai – die international einflussreichste und am häufigsten zitierte Institution der Bewertung von Einrichtungen der tertiären Bildung – berücksichtigt bei seiner Beurteilung die Geisteswissenschaften so gut wie nicht. Entsprechend liegen anglo-amerikanische so genannte Elite-Universitäten wie Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology und Oxford auf den Spitzenplätzen: Universitäten also, an denen – von Ausnahmen abgesehen – natur- und ingenieurwissenschaftliche Disziplinen dominieren und Geisteswissenschaften eine eher marginale Rolle spielen.
Fähigkeiten wie Kreativität und Vorstellungskraft, ganzheitliches Denken, geistige Beweglichkeit und Freiheit, also die Unabhängigkeit des Kopfes (Keith Thomas, Times Literary Supplement, 07.05.10), werden bei einer weiteren Verdrängung zumal der Philosophie und Philologien aus der Gesellschaft und zuletzt auch aus der akademischen Anpassung an so genannte Sachzwänge verschwinden; vielfache Verwendbarkeit der Menschen und unkritisches Verhalten des Individuums werden an ihre Stelle treten.
John Maynard Keynes, der umfassend gebildete Ökonom, formulierte bereits 1926 als Aufgabe des nicht-berufsorientierten Lernens, »Charakter und Geist des Menschen so zu entwickeln, dass er die Eigenheiten eines jeden Gegenstands, mit dem er sich in der Folge beschäftigt, schnell und sicher durchdringt« (Keynes 1926: 45).
Wilhelm von Humboldt hatte als Ziel einer allgemeinen Menschenbildung nachfolgender Generationen in seinen Schriften zur Schul- und Universitätsreform in Preußen zu Beginn des 19. Jahrhunderts von der Schule gefordert, sie solle den jungen Menschen so bilden, »dass er physisch, sittlich und intellektuell der Freiheit und Selbsttätigkeit überlassen werden kann« (von Humboldt 1964: 261). Die Schule müsse auf die »harmonische Ausbildung aller Fähigkeiten ihrer Zöglinge sinnen« (Humboldt 1964: 261), eine Spezialisierung solle später erfolgen.
Darum geht es heute, weltweit und Kulturen übergreifend: eine umfassende Bildung als Voraussetzung zukünftigen Wissens bei allen Menschen zu schaffen, die diese zu kritischen und verantwortungsvollen Bürgern bildet, damit die Demokratie stärkt und Diktaturen erschüttert.
Hier muss, jenseits aller kulturellen Besonderheiten rings um den Globus, angesetzt werden. Natur- und Geisteswissenschaften müssen dafür zusammenarbeiten und die demokratischen Staaten Europas Vorbild sein.
Literaturverzeichnis
Adorno, Theodor W. (1981): Theorie der Halbbildung. In: Dsl.: Gesellschaftstheorie und Kulturkritik. edition suhrkamp. Frankfurt/Main, 66-94.
Humboldt, Wilhelm von (1964): Werke in fünf Bänden. Band IV. Schriften zur Politik und zum Bildungswesen. Hg. von Andreas Flitner und Klaus Giel. Darmstadt.
Keith, Thomas (2010): Happiness and the Historian. In: Times Literary Supplement, 07.05.2010.
Keynes, John M. (1926): The End of Laissez-Faire. London.
Nussbaum, Martha (2010): Not for Profit: Why Democracy needs the Humanities. In: Princeton University Press.
Siemons, Mark (2010): Vertrauen ist die beste Medizin. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.06.2010, 31-32.