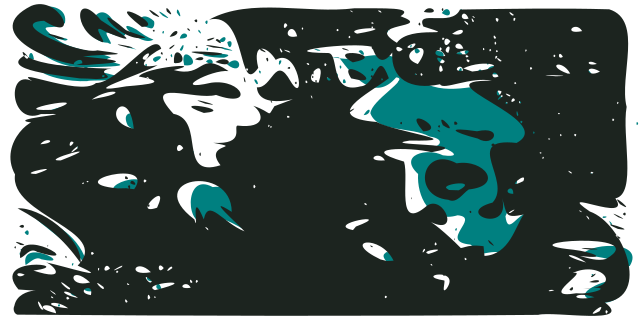von Peter Brandt
Der badische Staatsminister von Bodman sprach 1910 in der Ersten Kammer des Großherzogtums von der Sozialdemokratie als einer »großartigen Arbeiterbewegung zur Befreiung des vierten Standes«, ein im wilhelminischen Deutschland vermutlich einmaliger Vorgang. Die SPD war damals zusammen mit den badischen Nationalliberalen in eine feste, semi-parlamentarische Regierungszusammenarbeit eingebunden (ohne selbst an der Regierung beteiligt zu sein), den sog. ›Großblock‹, der die Phantasie so mancher Zeitgenossen beflügelte: War es nicht möglich, so fragten sich Etliche, auf diesem Weg die innen- und verfassungspolitischen Blockaden des autoritär-konstitutionellen Systems im Deutschen Kaiserreich aufzuweichen? Ein Reformbündnis von Bassermann bis Bebel? Doch nicht diesen Gedanken will ich hier weiterspinnen.
Bodmans zitierte Hochachtung vor der Sozialdemokratie verweist auf die kaum zu überschätzende zivilisatorische Mission der Arbeiterbewegung. Wissen ist Macht! Bildung für alle! Ferdinand Lasalles Vision der Verschmelzung von Wissenschaft und Arbeiterklasse. Empor zum Licht heißt die Festschrift des Dietz-Verlags. Sie kennen diese Schlagworte und wissen, zumindest andeutungsweise, was sich dahinter verbirgt. Wer von Ihnen (wie ich) Gelegenheit hatte, noch Menschen persönlich kennen zu lernen, die vor 1933 – aus der Arbeiterschaft kommend und als, meist gelernte, Arbeiter – sich teils autodidaktisch, teils mit Hilfe der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen, dann auch kommunistischen Bildungseinrichtungen eine politische und darüber hinaus vielfach geradezu gediegen klassische Bildung aneigneten, konnte eine Ahnung von der kulturellen Leistung der alten Arbeiterbewegung erhalten. Gewiss war vieles an dieser Bildungsbeflissenheit konventionell-bürgerlich. Doch die hyperkritische Analyse der ›bürgerlichen‹ Inhalte von Arbeiterbildung seitens linker Intellektueller, auch Historiker, ist mir stets etwas unheimlich gewesen – von Kritikern, denen in der Regel alles das in die Wiege gelegt wurde, was die bildungshungrigen Arbeiter früherer Epochen sich unter größter Mühe aneignen mussten.
In diesen Zusammenhang gehört die Geschichte des Dietz-Verlags im ersten halben Jahrhundert seiner Existenz. Die bahnbrechende, geradezu heroische Rolle von Heinrich Dietz ist von etlichen seiner Mitkämpfer im Nachhinein überzeugend gewürdigt worden. Seit rund zehn Jahren liegt uns mit der Arbeit von Angela Graf auch eine wissenschaftliche Biographie vor. Wie mühsam war dann später der Weg zur Wiederbelebung des Verlags nach 1945 bzw. 1961! Seitdem ist Beachtliches, teilweise Großes geleistet worden, nicht zuletzt auf dem erst seit den 1960er Jahren systematisch erforschten Feld der Geschichte der Arbeiter und Arbeiterbewegung (auch wenn die ambitiöse, qualitativ herausragende Gesamtdarstellung noch unvollendet ist), sowie in der Demokratiegeschichte und der Zeitgeschichte allgemein. Das Archiv für Sozialgeschichte ist ein Leuchtturm; im politisch-publizistischen Bereich hebe ich die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte sowie die Internationale Politik und Gesellschaft hervor, ebenso die der soliden politischen Bildung dienenden Lern- und Arbeitsbücher. Ich war erstaunt, von Zehntausender-Auflagen zu lesen, wobei ja klar ist, dass fachwissenschaftliche Werke im engeren Sinn sich in einer ganz anderen Größenordnung bewegen müssen.
Wenn in der bekannten Unübersichtlichkeit heutiger gesellschaftlicher Verhältnisse die politische Wirkung, sogar die Überlebensfähigkeit solche einer Einrichtung wie eines der Sozialdemokratie verbundenen Verlags, abgesehen von der gewiss relevanten Frage seiner finanziellen Ausstattung, weniger deutlich auszumachen ist als zu Zeiten der klassischen Arbeiterbewegung, dann liegt das – banal genug – zunächst an Tendenzen, mit denen alle programmatisch orientierten Verlage bzw. alle Verlage überhaupt konfrontiert sind. Ich spreche von den neuen computergestützten Medien, in erster Linie dem Internet, nicht ohne hinzuzufügen, dass unsere Erfahrungen an der FernUniversität in Hagen besagen, und zu diesem Schluss neigen wohl auch Leute, die sich noch eingehender damit beschäftigen, dass die gedruckten Medien bei vermehrter Nutzung elektronischer Medien keinesfalls überflüssig werden. Zweitens muss man die mit den erwähnten technischen Neuerungen untrennbar verbundene, immer weiter gehende Kommerzialisierung und marktkapitalistische Globalisierung auch und gerade dieses Wirtschaftszweigs erwähnen.
Dazu kommt nach meinem Eindruck noch etwas Drittes: die modernen konsumkapitalistischen Gesellschaften des Westens, einschließlich der bundesdeutschen, haben im Lauf der Zeit eine große Fähigkeit entwickelt, Kritik und sogar Provokation auszuhalten, sich diese gewissermaßen in einem gewaltigen Verdauungsvorgang zu vereinnahmen. Ich spiele damit auch auf das an, was Herbert Marcuse vor Jahrzehnten mit dem problematischen Begriff der »repressiven Toleranz« zu erfassen meinte.
Menschen, die aus der DDR-Diktatur in die westdeutsche liberale Ordnung verschlagen wurden, mussten bitteres Lehrgeld bezahlen, etwa Wolf Biermann oder Rudolf Bahro, die dann vom Westen aus dem Sozialismus in Deutschland ganz neue Impulse geben wollten, und sie haben sich letztlich entweder angepasst oder sind als esoterische Sektierer abgestempelt worden. Sie kamen aus Verhältnissen, wo das Aussprechen, gar das Veröffentlichen unerwünschter Nachrichten oder Meinungsäußerungen schon als solches eine ungeheuere Sprengkraft besaß, in Verhältnisse, wo man fast alles sagen und schreiben durfte, ohne dass es unbedingt Folgen hatte.
Die akademische Disziplin ›Geschichtswissenschaft‹, der ich verpflichtet bin, ist durch den Gebrauch der Schrift definiert. Orale Kulturen, die dem Historiker ja eine ganz andere Quellenlage bieten, gehören in die von der Disziplin ›Geschichte‹ zumindest institutionell abgetrennten Bereiche der Vor- und Frühgeschichte, der Archäologie, der Anthropologie und der Ethnologie. Unser Selbstverständnis wie unser ganzes Alltagsleben sind vom Schriftgebrauch geprägt, vom Schreiben und vom Lesen hauptsächlich gedruckter Mitteilungen. Folgen Sie mir auf einen kleinen Ausflug in vormoderne Perioden der Menschheitsgeschichte:
Es ist heute, wenn ich richtig sehe, bei Archäologen und Historikern unumstritten, dass die Schriftkultur der Menschheit wesentlich älter ist, als die meisten der Anwesenden, mich eingeschlossen, das in der Schule gelernt haben. Damals ging man davon aus, das piktographische Schriftsystem der Sumerer – mit einigen Tontafeln, die Angaben zum Warenverkehr enthalten, als den ältesten Zeugnissen – hätte um 3200 v. Chr. am Anfang gestanden. Durch die Kombination einer genaueren Anwendung von Radiokarbonmessungen (C14-Methode) und der Baumringaltersbestimmung ist es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, andere archäologische Funde chronologisch neu zuzuordnen und so zu einer deutlich veränderten Abfolge der frühesten Schriftkulturen zu gelangen. Das betrifft altägyptische Schriftzeichen aus der prädynastischen Epoche, als Ägypten noch in zwei Reiche geteilt war, die auf in Gräbern gefundenen Siegeln identifiziert werden konnten. Sie sind, wenn auch nicht wesentlich, älter als die sumerischen.
Spektakulär ist die Neubewertung der Datierung der sog. Donauzivilisation im Südosten Europas, die sich – vermutlich unter dem Druck einer ökologischen Katastrophe – bereits im 6. vorchristlichen Jahrtausend herausbildete und zumindest seit 5300 v. Chr. eine Art von Schrift kannte. Es war eine Zivilisation, deren Merkmale sie den anderen frühen Hochkulturen an die Seite rücken: Ackerbau und Vorratswirtschaft, städteähnliche Siedlungen, diversifiziertes Handwerk einschließlich der Verarbeitung von Metall sowie ein elaboriertes kulturell-symbolisches Instrumentarium. Offenbar handelte es sich um eine zwar arbeitsteilige und entsprechend differenzierte, aber klassenlose und zudem geschlechtsegalitäre Gesellschaft ohne Staat – während lange angenommen worden war, auf einem solchen hohen Entwicklungsniveau, das sich auch noch im Vorhandensein einer Schrift manifestierte, hätten sich soziale und politisch-staatliche Herrschaftsbeziehungen fast automatisch ergeben. Ein für demokratische Sozialisten, nicht nur in Europa, insofern hoffnungsfroh stimmender frühgeschichtlicher Befund!
Die anderen Weltregionen deutlich vorauseilende zivilisatorische Entwicklung an den Ufern der Donau und ihrer Nebenflüsse war übrigens nicht von unseren indogermanischen ›Vorfahren‹ getragen, die noch als Viehnomaden lebten. Deren Vordringen aus Südrussland auf die Balkanhalbinsel stoppte dann vielmehr gegen Ende des 4. vorchristlichen Jahrtausends den Schriftgebrauch – die Geschichte kennt also auch dramatischen, lang andauernden Rückschritt -, bevor die minoisch-kretische Kultur unter dem Einfluss von Flüchtlingen aus der Donauregion um die Mitte des 3. Jahrtausends den Schriftgebrauch wieder belebte. Im 2. Jahrtausend spielte dann der Kulturtransfer aus den Nahen Osten für Europa, namentlich den Mittelmeerraum, eine ganz wesentliche Rolle: das gilt nicht zuletzt für die Schrifttechnologie.
Über Jahrtausende war der Schriftgebrauch ein höchst elitäres Phänomen. Seit der Entstehung skribaler Hochkulturen im Zweistromland und am Nil lag das Schriftmonopol in den Händen einer kleinen, spezialisierten Schicht professioneller Schreiber oder/und der Herrschaftsträger bzw. eines mehr oder weniger großen Teils davon. Das war in der griechischen und römischen Antike so, und in den aus dem Zerfall des Römischen Reiches entstandenen mittelalterlichen territorialen Machtgebilden nicht viel anders – abgesehen davon, dass im größten Teil Europas über Jahrhunderte allein die Institution der Kirche, speziell die Mönchsklöster, die Schreib- und Lesefähigkeit bewahrten, kultivierten und so die Technik wie das in der klassischen Antike bereits gesammelte Wissen weitertransportierten, bis mit dem allgemeinen wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Aufschwung seit dem 11./12. Jahrhundert n. Chr., im Bildungswesen begleitet von der Errichtung der weltlich-autonomen ersten Universitäten (zuerst in Bologna und Paris) ein neues Zeitalter ständiger Wissensakkumulation und Literalisierung einsetzte.
Solange Wissen nur handschriftlich gesichert und über die Herstellung von Kopien verbreitet werden konnte, blieb dieser Vorgang jedoch auf eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe begrenzt. Erst die Erfindung des Buchdrucks um die Mitte des 15. Jahrhunderts machte es technisch möglich, Texte in großer Menge zu vervielfältigen. Der inzwischen erreichte Grad der Marktverflechtung und der Verdichtung von Kommunikation, die Einflüsse der Renaissance (Akademiewesen) bzw. des den Gebrauch der Muttersprache anstelle des Lateinischen fördernden Humanismus sowie anderer emanzipatorischer Strömungen erzeugten zusammen einen gesellschaftlichen Resonanzboden, der einen ersten Schub bei der Ausbreitung der Schreib- und Lesefähigkeit unter den Nichtexperten des Schriftlichen begünstigte.
Hinzu kam, namentlich im deutschsprachigen Mitteleuropa, nicht zuletzt derjenige religiöse – und das hieß zu dieser Zeit: auch politische – Umbruch, der als Reformation bezeichnet wird und der auch von massiven sozialen Unruhen – mit dem großen Bauernkrieg von 1524-1526 im Zentrum – begleitet war. Stets diente die Drucktechnik über das neue Medium der Flugschrift zum Transport der rebellischen Ideen. Das gilt auch für die berühmte Antwort des jungen Augustinermönchs und Theologieprofessors Martin Luther aus Wittenberg von 17. und 18. April 1521, der – von Kaiser Karl V. gebannt – vor dem Wormser Reichtags seine »leren und buecher …, so ain zeit her von [ihm] ausgegangen sein« widerrufen sollte, aber auf die Gefahr hin, wie Johann Hus ein Jahrhundert früher, als Ketzer verurteilt und hingerichtet zu werden, standhaft blieb. Man schätzt, dass Luthers Worte in rund 500 000 Exemplaren kursierten.
Bei Luthers Verteidigung seiner Position stand das Verständnis der von ihm ins Deutsche übersetzten Bibel, der Heiligen Schrift, im Mittelpunkt, über das er zum breiten Publikum, an dessen eigenes Urteil appellierend, predigte, eine ungeheure, die Autorität der kirchlichen Hierarchie angreifende Herausforderung. In Worms bekannte sich der Reformator zu seinen selbst verfassten Texten im originalen Wortlaut und distanzierte sich von böswilligen oder wohlmeinenden Verfälschungen des Wortlauts oder der Auslegung, für die er die Verantwortung ablehnte. Luther und seine Gegner führten somit nicht zuletzt einen Streit um gedruckte Worte, die fast rauschhaft verkündet, breit erörtert, begeistert aufgenommen oder kompromisslos verdammt wurden.
Nachdem es also im Zuge des Erwähnten um 1500 zu einer ersten Ausdehnung des Lesen-Könnens und des Lesen-Wollens gekommen war, dann im 17. Jahrhundert durch den Dreißigjährigen Krieg wohl erhebliche Rückschritte zu verzeichnen waren, setzte im 18. Jahrhundert, vor allem seit der Jahrhundertmitte im Zeichen des Aufgeklärten Absolutismus, ein zweiter, jetzt nicht mehr unterbrochener, weil von dem beschleunigten und sich verstetigenden gesamtgesellschaftlichen Wandel gespeisten, Alphabetisierungsschub ein, der nach und nach bis in die Unterschichten durchschlug. Manches blieb längere Zeit eher programmatisch, so die Einführung der allgemeinen Schulpflicht durch den preußischen König Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1717 (unter der Maßgabe, dass geeignete Räume zur Verfügung stünden). Es ist unverkennbar, dass der Alphabetisierungsgrad in den deutschen Staaten, namentlich in Preußen, durchgehend relativ hoch war und dass dort erheblich früher als anderswo der Analphabetismus praktisch eliminiert war. Auch im späten 18. und im 19. Jahrhundert spielten politische Faktoren eine verstärkende Rolle, so die radikale Aufklärung und die Französische Revolution, die antinapoleonischen Befreiungskriege, die bürgerlich-liberale und eben auch die frühe sozialistische Arbeiterbewegung.
Der Kreis derjenigen, die als Kunden der Buch- und Zeitschriftenproduktion in Frage kamen, die bürgerliche Bildungsschicht und ein Teil des Adels, war um 1800 immer noch sehr begrenzt, doch reichte er schon weit über die Gelehrtenzirkel der Frühen Neuzeit hinaus. Im Zuge der mit der sog. Leserevolution dieser Jahrzehnte eng verbundenen Vereinsbewegung schossen seit den 1770er Jahren ›Lesegesellschaften‹ aus dem Boden, deren unmittelbarer Zweck sowohl die gemeinsame Anschaffung der auch für Angehörige des gehobenen Bürgertums häufig kaum erschwinglichen Literatur als auch die Diskussion des Gelesenen war: vor allem Periodika, Sachbücher und Nachschlagewerke, weniger Belletristik. Die Gründung der Lesegesellschaften war ein Teilprozess eines allgemeineren Vorgangs, der u. a. die Kommerzialisierung und quantitative Ausweitung der Buchherstellung, des Buchhandels und des Zeitungs- und Zeitschriftenwesens sowie die Veränderung des Leseverhaltens der Menschen umfasste. Während am Beginn des 18. Jahrhunderts weniger als 600 deutschsprachige Bücher erschienen, waren es 1764 bereits über 1300, 1800 fast 4000, 1870 über 10 000 und am Ende des 19. Jahrhunderts rund 24 000.
Schon im 16./17. Jahrhundert befürworteten und förderten manche Schreib- und Lesefähige die Literalisierung der Mittel- und Unterschichten. Dabei ging es ihnen in der Regel um die Vertiefung der Bibelkenntnis und die bessere Einübung christlich-konfessioneller Grundregeln durch Lektüre von Gebets-, Gesangs- und Anstandsbüchern. Dazu kam durch die Aufklärung das Bemühen von Volkspädagogen um praktische Belehrung, etwa über moderne agrarische Anbaumethoden, und um moralische ›Verbesserung‹ der ›niedrigen Klassen‹ nach dem eigenen Maßstab. Ihre Entsprechung fanden diese pädagogischen Ansätze in Anstrengungen der Betroffenen selbst oder besser gesagt: der Energischsten und geistig Regsten unter ihnen, schreiben und lesen zu lernen, wie sie, für England schon für die Zeit seit dem späten 18. Jahrhundert überliefert, in autobiographischen Mitteilungen einfacher Arbeiter als wesentlicher Handlungsimpuls aufscheinen.
Es liegt auf der Hand, dass die Literalisierung der breiten Volksschichten eine große Hürde in deren Lebensformen fand. Dazu gehörte die Umgangssprache dieser Sozialgruppen. Die deutsche Hochsprache war um 1800 ein bürgerlich-nationales Projekt, das gegen den weitgehend das Französische nutzenden Adel, die lateinische Messe im Katholizismus und vor allem die dialektverhafteten Unterschichten in Stadt und Land durchgesetzt werden musste. Auch die materielle und personelle Ausstattung des Volksschulwesens war bis weit ins 19. Jahrhundert sehr bescheiden. Zudem fand die vermeintliche ›Lesewut‹ Minderjähriger und sozial Abhängiger viel Kritik bei Eltern und Erziehern, bei Vertretern der Obrigkeit und der Kirchen, bei Arbeitgebern und bei Anhängern einer elitären Bildungsidee. Man klagte über Müßiggang, autoritätsfeindliche Beeinflussung und seelische Beschädigung durch – wie man dann später sagte – Schund- und Schmutzliteratur. Weil indessen ökonomische und staatliche Interessen zunehmend eindeutig auf vollständige Alphabetisierung gerichtet waren, konnten solche Vorbehalte allenfalls verzögernd, doch nicht nachhaltig hemmend wirken.
Erwähnen sollte ich aber noch die Zwischenformen der halb-literaten, halb-oralen Kommunikation, wie sie lange den Gesamtprozess der Literalisierung begleiteten. Alle irgendwie schriftbezogenen Verständigungsformen wie das Vorlesen, aber auch der Gesang, die Katechese und die Predigt (die ja speziell im deutschsprachigen Gottesdienst der Protestanten in den Mittelpunkt gerückt war) beeinflussten die daran Teilnehmenden im Sinne einer zumindest partiellen Durchbrechung der tradierten, für die Masse der Bevölkerung noch eng begrenzten Daseinsform und die stetige Erweiterung des gedanklichen Horizonts. Im übrigen beschränkte sich das regelmäßige Vorlesen nicht unbedingt auf Kinder und Analphabeten. Vielleicht kennen Sie das Beispiel der deutschen Zigarrenarbeiter, deren frühe gewerkschaftliche und politische Aktivierung – seit Mitte des 19. Jahrhunderts – neben strukturellen Gründen und bestimmten Traditionen verschiedentlich auch mit der verbreiteten und vielfach geduldeten Sitte des Vorlesens von Schriften der Arbeiterbewegung, in der Regel Zeitungen, während der Arbeitszeit in Verbindung gebracht worden ist.
Möglicherweise habe ich Sie mit dem Rückgriff auf unsere – in einem zugegebenermaßen sehr vermittelten Sinn – Vorgeschichte ein wenig überrascht. Mein eigentlicher Kompetenzbereich in der Forschung und Lehre sind ja das 18. – 20. Jahrhundert der deutschen und europäischen Geschichte. Wir sind aber am Historischen Institut der FernUniversität in Hagen, wo das Fach Geschichte nur drei Lehrstühle umfasst, stärker als an manchen anderen Orten genötigt, über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Die Schriftlichkeitsgeschichte gehört zu den Schwerpunkten unseres Lehrgebiets ›Geschichte und Gegenwart Alteuropas‹ und ich habe hier deutlich von den Arbeiten meiner Kollegen profitiert. Generell ist es mir ein Anliegen, die Bedeutung auch der vormodernen Geschichte (und übrigens auch der außereuropäischen Geschichte, die in Hagen den dritten Arbeitsbereich bildet) für das Verständnis der Welt, aus der wir kommen und in der wir leben, zu propagieren, und dafür fand ich den heutigen Anlass durchaus passend.
[Vortrag bei der Festveranstaltung zum 125jährigen Jubiläum des Verlags J. H. W. Dietz Nachf., Bonn, am 14. Februar 2007, rev. Fassung]