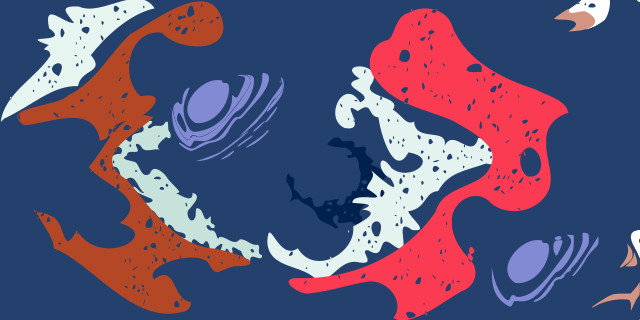von Johannes R. Kandel
Ed Husain ist Schriftsteller und bekannt geworden durch seine autobiografischen Aufzeichnungen über sein Leben als Islamist in England und seinen Ausstieg (The Islamist, 2007). Er ist zurzeit außerplanmäßiger Professor an der Georgetown Universität in Washington DC.
Husains Familie stammt vom indischen Subkontinent, der Vater aus Indien und die Mutter aus Ost-Pakistan (seit 1971 Bangladesch). 1961 kam der Vater als junger Mann auf Arbeitssuche nach England, gründete eine Familie und erzog seine Kinder im islamischen Glauben (Ed war der Älteste). Er war ein frommer Muslim und verehrte diverse Sufi-Meister aus der Heimat. Ed folgte ihm in dieser betont spirituellen Richtung nach, geriet aber in die Kreise militanter Islamisten, aus denen er sich nach Jahren harter Auseinandersetzungen schließlich lösen konnte.
Eine Reise durch das muslimische Britain
2018/19 trat er eine Reise an, die ihn durch neun Städte des Vereinigten Königreichs führte: Dewsbury, Manchester, Blackburn, Bradford, Birmingham, Cardiff, Belfast, Edinburgh, Glasgow und London. Die meisten dieser Städte wiesen starke muslimische Bevölkerungsanteile auf, insbesondere London, Blackburn, Bradford, Birmingham und Manchester. Deutlich kleinere Anteile zeigen Cardiff, Edinburgh, Glasgow und Belfast. In Großbritannien leben 3,3 Millionen Muslime (= 5 Prozent der Gesamtbevölkerung), die in rund 2000 Moscheen Allah preisen. Dazu kommen tausende von islamischen Schulen. Der Islam ist die zweitgrößte und am schnellsten wachsende Religionsgemeinschaft in Großbritannien. Die ethnisch-kulturelle Herkunft der überwältigenden Mehrheit ist asiatisch (Indien, Pakistan, Bangladesch, Kaschmir) und sie sind überwiegend sunnitisch.
Unangemeldet besuchte Husain Moscheen, sprach mit Imamen und Moscheevereins-Aktivisten, mit Moscheebesuchern und dem sprichwörtlichen Mann auf der Straße. Seine Herkunft, die Vertrautheit mit Lehren und religiöser Praxis des Islam und seine Sprachkenntnisse des Arabischen, Urdu und Bengali erlaubten ihm, einen veritablen Insider-Bericht zu schreiben.
Husain ist ein sehr guter Beobachter und ein brillanter Erzähler, wie schon bei seinem Erstling The Islamist. Der spannend geschriebene Reisebericht mit seiner unaufgeregten, sachlichen, differenzierten Sprache erinnert an die berühmten kritischen Reports des Reiseschriftstellers und Nobelpreisträgers V.S. Naipaul (1932-2018) über die islamische Welt. (Among the Believers, 1981; Beyond Belief: Islamic Excursions Among the Converted Peoples, 1998). Für den mit dem Islam nicht vertrauten Leser, erklärt Husain die besuchten Orte und Moscheen, gibt historische Hintergrundinformationen zu islamischen Strömungen, Moscheevereinen, Schulen, Imamen und wichtigen »Shaikhs«. Er bleibt immer fair, auch gegenüber Personen und Gruppen, die er sehr entschieden ablehnt. Für den kritischen Beobachter der islamistischen Milieus, wirkt es gelegentlich zu unterkühlt, obwohl er auch Klartext spricht und deutliche Kritik übt. Sein Buch ist kein Großangriff gegen den Islam und die muslimischen communities, er fühlt sich als deren Teil. Genau das macht den besonderen Wert seines Berichtes aus. Er gewinnt eine aussagekräftige Momentaufnahme islamischer Glaubenslehren in ihren verschiedenen Ausprägungen, Lebensweisen, Frömmigkeit, religiös-kulturellen Praktiken, institutionellen Strukturen von Moscheen, Trägern, Finanzierungen und politischen Aktivitäten. Einen zentralen Platz nehmen seine Anmerkungen zum Verhältnis von Muslimen und Nichtmuslimen, ethnischen Gruppen und binnen-muslimischen religiösen Orientierungen ein.
Es gibt zahlreiche Studien, die nahelegen, dass der ›britische Islam‹ von eher konservativ-orthodoxen, fundamentalistischen und islamistischen Strömungen geprägt wird. Husains Reisebericht bestätigt dies in der Grundtendenz, bringt aber auch einige (wenige) Beispiele für liberale Haltungen, Pluralismus und Offenheit (vorzugsweise Edinburgh und Belfast). Die meisten Moscheen, die er besuchte, waren ethnisch asiatisch zusammengesetzt: Inder, Pakistani, Bangladeschis und auch Kaschmiris. Der in diesen Moscheen gelehrte Islam wird seit vielen Jahrzehnten von den ›Deobandis‹ geprägt, einer höchst konservativen Islamvariante (vorsichtig formuliert!), die Mitte des 19. Jahrhunderts in Indien entstand. Im Dorf Deoband (etwa 200 km nördlich von Delhi) gründeten fromme Imame eine Bildungsanstalt, das ›Darul Uloom‹ (Haus des Wissens), um die indische religiös-kulturelle Identität gegen die englische Kolonialherrschaft zu behaupten. Heute ist ›Deoband‹ neben der ›Al-Azhar‹-Universität in Kairo das wichtigste Zentrum der islamischen Gelehrsamkeit. Unzählige Imame wurden hier ausgebildet und kamen im Zuge der Migrationswellen in den fünfziger und sechziger Jahren nach Großbritannien. Nicht zu vergessen ist auch, dass die Taliban (=Religionsschüler) ihre religiöse Schulung in Deobandi-Moscheen in Pakistan erhielten. Die meisten Moscheen in Großbritannien gehören zu den Deobandis. In Konkurrenz zu diesen stehen die einflussreichen ›Barelwis‹, eine Sufi-Bewegung, gegründet im 19. Jahrhundert in Nordindien. Sie sind gleichermaßen fundamentalistisch orientiert, unterscheiden sich aber von den Deobandis in der Betonung religiöser Praktiken und Riten: Ostentative Verehrung des ›Propheten‹ Mohammed, Feier seines Geburtstages, Verehrung von Islamgelehrten als fast ›Heilige‹, Verehrung der Gräber prominenter Gelehrter und ekstatische Gebetsformen (›zikr‹).
Ed Husain wurde bei seinen Besuchen überwiegend freundlich aufgenommen. In seltenen Fällen begegneten ihm Misstrauen und Abwehr. Häufig aber stockte die Bereitschaft, insbesondere der Imame, zu kritischen Fragen Stellung zu nehmen. Beredtes Schweigen war dann auch eine Antwort. Was Husain im Blick auf religiöse Lehren, Praktiken, kulturelle Lebensweisen und Verhalten britischer Muslime herausfand, ist schon erschreckend. Seine wichtigsten Erkenntnisse führe ich im Folgenden auf.
Ablehnung des Staates und Abschottung
Trotz (oft bereits langjähriger) britischer Staatsangehörigkeit gibt es ein deutliches Misstrauen gegenüber dem säkularen Staat und der Gesellschaft der ›unbelievers‹ (kuffar) von denen man sich am besten fernhält. Schon im Koran werde klar gesagt, dass Muslime Christen nicht zu Freunden nehmen sollten (Sure 5,51). Ob in Dewsbury, Blackburn, Bradford, Birmingham oder Manchester: Die muslimischen communities haben Stadtteile und ganze Städte in asiatisch-muslimische Inseln verwandelt und das traditionelle englische Leben zum Erliegen gebracht: Zahllose Pubs sind geschlossen, das englische Business hat sich zurückgezogen, bzw. wurde vertrieben (»chased out«). Manche Geschäftszeilen ähneln jenen in Karachi, Islamabad oder Dhaka. Asiatische Restaurants mit ›halal‹-food dominieren Stadtzentren. Husain wundert sich häufig, dass er an manchen Tagen kein einziges weißes Gesicht sieht.
Die Abschottung der muslimischen Gemeinschaften bestimmt das Stadtbild. Längst haben sich religiös-kulturelle Parallel- und Gegengesellschaften etabliert. Die selbstgewählte Ghettoisierung führt auch zu aggressiver territorialer Anmaßung. Muslime ›verteidigen‹ ihre Viertel gegen ›Ungläubige‹, wobei zunehmend ein Rassismus gegen Weiße zu bemerken ist. In Blackburn trifft Husain zwei weiße Männer, die sich über ›No-Go-Areas‹ für Weiße beklagen. Ungläubig fragt er nach und bekommt die Bestätigung:
In Bradford sagt die Lehrerin und Direktorin einer Theatergesellschaft, die behinderten Kindern hilft, unter Tränen: »I see us becoming an apartheid city« (S. 120). Fanatische Islamisten aus Bradford, Anhänger von Pir Maroof, dem verehrten Imam, verbrannten 1989 Salman Rushdies Satanische Verse und dokumentierten auf diese Weise ihre Zustimmung zur Fatwa Ayatollah Khomeinis, die zur Ermordung des Schriftstellers aufgerufen hatte (siehe dazu das Buch von Kenan Malik, From Fatwa To Jihad, 2009). Dass derjenige, der den ›Propheten‹ beleidigt, getötet werden muss, wird jedoch nicht nur in Bradford akzeptiert.
Islamismus, ›Caliphism‹ und Salafismus
In zahlreichen Moscheen wächst der Einfluss islamistisch-salafistischer Gruppen, welche die Wiedereinführung des Kalifats fordern. Husain nennt das »caliphism«. In einer ganzen Reihe von Moscheen wird zudem offenkundiger Dschihadismus verbreitet. Das Hauptquartier der aggressiv-missionarischen Vereinigung ›Tablighi Jama’at‹ in Dewsbury um die Markazi Moschee war der Resonanzboden für die drei Selbstmordattentäter in der Londoner U-Bahn am 7. Juli 2005. 59 Personen wurden getötet, über 700 verletzt. Der Rädelsführer der Mördergruppe, Mohammed Sidique Khan und seine Kumpane, pflegten in der Markazi Moschee zu beten. Weitere junge Muslime aus Dewsbury schlossen sich dem Dschihad des ›Islamischen Staates‹ im Irak an. In Manchester spricht Husain mit dem Imam u.a. auch über die ›Blasphemie‹-Frage. 2011 wurde der Gouverneur von Punjab, Salman Tanseer von seinem eigenen Leibwächter ermordet. Sein Verbrechen: Er hatte sich für die seit Jahren wegen angeblicher Blasphemie eingekerkerte Christin Asia Bibi eingesetzt. Der Mörder (Mumtaz Qadri) wird bis heute als Nationalheld gefeiert und hunderttausende pilgern am Jahrestag seiner Hinrichtung zu seinem Grab. Der Imam hält sich mit seiner Meinung bedeckt, ein Buchhändler aus Birmingham (Madina Bookshop) schweigt beharrlich. Zahlreiche aus Pakistan stammende Muslime finden offensichtlich die in Pakistan geltenden menschenrechtswidrige ›Blasphemy Laws‹ in Ordnung und wünschen ihre Anwendung auch in Großbritannien
›Salafisten‹, sind fundamentalistische Muslime, die nur Koran und Sunna sowie die ›frommen Väter‹ (al-salaf-al-salih) als authentische islamische Autoritäten anerkennen und sich strikt und buchstäblich an Mohammeds Vorbild orientieren. Das geht von der Barttracht, über Kleidung (Gebetskappe, wallendes weißes Gewand bis zu den Knöcheln) bis zur täglichen Körperhygiene. Wie angeblich der ›Prophet‹ putzen sie sich die Zähne nur mit einem Zweig (miswak). Scharf wenden sie sich gegen ›Neuerungen‹ (bid’ah), die nach dem in einem Salafi-Buch zitierten Gelehrten Sufyan ath-Thawri vom Satan mehr geliebt werden als die Sünde (S. 176). Musik ist »Bid’ah« vor der in einem Salafi-Buchladen in Birmingham als The Devil’s Voice & Instrument gewarnt wird (S.163). In Dewsbury bekommt Husain eine kleine Broschüre zugesteckt, geschrieben von einem prominenten britisch-muslimischen Geistlichen, Mohammed ibn Adam al-Kawthari, der, sich auf einen Hadith beziehend, das Spielen oder Anhören von Schlagzeug, Violine, Flöte, Laute, Mandoline, Harmonium und Klavier strikt untersagt (S. 26). Auch Gesang und Tanz sind verboten. Fernsehen und Fotografieren sind auch »haram». Salafis hoffen auf die Wiederherstellung des Kalifats. Ahmed aus Birmingham, ein somalischer Freund von Husain, erklärt: »I have no government. We are waiting for our government of the sharia to return again, headed by a caliph« (S. 172). Dieses wird allerdings nur ›kommen‹, wenn alle Muslime makellos fromm sind und viele ›Ungläubige‹ sich zum Islam bekehrt haben. Husain kommentiert das trocken: »The underworld of caliphism is on show here« (S. 163). (In einem Report der Henry Jackson Society wurde festgestellt, dass die Zahl der wahhabitischen und salafistischen Moscheen von 68 im Jahre 2007 auf 114 im Jahre 2014 angewachsen ist). Salafistische Positionen finden in Großbritannien einen breiten Resonanzboden. 2016 ermittelte das ›Policy Change Institute‹ in einer Studie, dass 43 Prozent der britischen Muslime die Einführung der Scharia als Ersatz für das säkulare Recht befürworteten. 16 Proznet wollten wenigstens Teile der Scharia ins englische Recht implantiert sehen. Sie fanden sogar im Erzbischof von Canterbury einen Befürworter, der 2008 eine schariagemäße »supplementary jurisdiction« gar für unvermeidlich hielt und dafür von den Islamisten großen Beifall erhielt (Siehe dazu: Johannes Kandel/Reinhard Hempelmann, Der Erzbischof und die Scharia. In: Materialdienst der EZW, 4/2008, S. 134ff.). Inzwischen ist es den muslimischen Organisationen (allen voran Islamisten!) gelungen, mit ihren ›Sharia Courts‹ eine parallele Rechtsordnung (parallel legal system) zu schaffen, die vor allem zu Lasten der muslimischen Frauen geht. Husain weiß nicht, wie viele ›Shariah Courts‹ es überhaupt in Großbritannien gibt (S. 128).
Husain begegnete überwiegend ›friedlichen‹ Salafis (auch als ›pietistic‹ bezeichnet: siehe Nina Bowen, Medina in Birmingham, 2014, S. 59), aber es fielen ihm auch ›Jihadis‹ auf. Für diese ist der ›Dschihad‹ (das Streben auf dem ›Wege Gottes‹) ausschließlich eine Anweisung zur Gewalt. Aus der Salafi-Moschee in Cardiff (Al-Manar) waren zwei Zwanzigjährige auf einem Propaganda-Video des ISIS in Syrien zu sehen. Natürlich dementiert die Moschee jede Verantwortung für deren Radikalisierung und verweist auf ›Online-Radikalisierung‹. Husain ist skeptisch. Der Vater der beiden Salafis führt ihre Radikalisierung auf »organised networks of Muslim extremists« zurück (S. 184). Prinzipiell halten sich die Gesprächspartner Husains in dieser Frage zurück. Offene dschihadistische Propaganda wird selbst in Großbritannien strafrechtlich verfolgt, aber aus einer Reihe von Studien wissen wir, dass der Dschihadismus im Vereinigten Königreich fest verankert ist. Eine starke Position, insbesondere in Universitätsstädten, hält die islamistische ›Hizb-ut-Tahrir‹ (=Partei der Befreiung), der Husain in jungen Jahren verfallen war (The Islamist, S. 83ff.). In zahlreichen islamischen und europäischen Staaten hat diese Partei Betätigungsverbot, in Deutschland seit 2003. In Großbritannien darf sie sich frei entfalten und ihre Propaganda verbreiten. Husain hält sie heute für ›faschistisch‹ (S. 279).
Ein trübes Kapitel ist auch der Umgang Britischer Muslime mit der Geschichte des Islam. Denn da gibt eine Reihe dunkler Punkte, z.B. die Sklaverei, bekanntlich in breitem Maße von Muslimen praktiziert (Siehe: Egon Flaig, Geschichte der Sklaverei, 20112, S. 83ff.). Husain berichtet über einen arabischen politischen Aktivisten, der 2016 in der Londoner Regent’s Park Moschee Unterschriften gegen ISIS sammelte. Der Scheich, ein weißer Engländer, weigerte sich zu unterzeichnen, weil in dem Brief an ISIS von muslimischer Sklaverei die Rede war, die gerade von ISIS neu eröffnet worden war (Sklavenmärkte mit jesidischen Frauen!). Begründung: Sklaverei sei im Koran erlaubt und die schafiitische Rechtsschule befürworte sie. Man dürfe sich deshalb nicht dagegen stellen.
Islamophobie?
Muslimische Organisationen, wie z.B. der ›Muslim Council of Britain‹ (MCB), beklagen immer wieder ein anti-muslimisches Klima, Feindseligkeiten und auch Attacken. Anas Sarwar, der eine politische Bilderbuch Karriere machte (MP für Glasgow 2010-2015) beschwerte sich im Gespräch mit Husain über Islamophobie. Er hatte eine parteiübergreifende Untersuchungskommission ins Leben gerufen, die eine »Public Inquiry into Islamophobia in Scotland« erstellen sollte. Das scheiterte offensichtlich schon daran, dass sich das Gremium nicht über eine Definition von ›Islamophobie‹ einigen konnte (S. 215).
Allerdings weht in Belfast tatsächlich ein scharfer Wind. In der Hauptstadt des von fast vierzig Jahren ›Northern Irish Conflict‹ zerrissenen und gespaltenen Nordirland fühlt sich eine kleine muslimische Gemeinschaft unter Druck. 300 »hate crimes« (was immer das auch sein mag) gegen sie seien in den letzten fünf Jahren registriert worden (S. 194). Es hat eine Reihe von ernsthaften Attacken gegen Muslime gegeben, von paramilitärischen Gruppen. Die heiße Phase des Konfliktes ist seit 1998 zwar vorbei, aber die Gräben zwischen den streitenden Katholiken und Protestanten sind immer noch tief, im Stadtbild sichtbar an den hohen Mauern (Dividing Lines), die katholische und protestantische ›hotspots‹ voneinander trennen. Dazwischen versuchen die Muslime islamisches Leben zu organisieren. Husain trifft auf eine offenere Gemeinschaft als z.B. in Bradford oder Blackburn. Das Verhältnis von Frauen und Männern ist entspannter. Zwei Frauen berichten über ihre Arbeit in der kleinen Moschee, sie halten Augenkontakt mit dem Autor und geben ihm sogar die Hand (S. 194ff.). Sie sind die Aktivistinnen hier und zeigen erstaunliche ›liberale‹ Ansichten in Bezug auf die Genderfrage. Es gäbe auch »gay Muslims here« (S. 197). Der junge Shaikh Mustaqbil, nicht im arabischen Gewand, wirkt im Gespräch locker und ist aufgeschlossen. Der dann in der Moschee predigende Imam, Shaikh Ahmed, wettert allerdings gegen ›Neuerungen‹ und outet sich somit als Salafi, aber, wie Husain anmerkt, »the mellowest of the salafis« (S. 200).
Islamische Schulen im Zwielicht
Immer mehr staatsunabhängige islamische Schulen entstehen. Das ist im Prinzip nicht zu beanstanden. Doch die von Moscheen und islamischen Schulen vermittelte religiöse Bildung ist sowohl inhaltlich als auch didaktisch konservativ bis fundamentalistisch. In Blackburn entstand 1973 die erste exklusive islamische Schule in Europa, teilweise von Saudi-Arabien finanziert. Nach anfänglichem Zögern erlaubt der Direktor das ›Darul Uloom‹ zu besichtigen und Fragen zu stellen. Eine Schülergruppe führt Husain. Sie verehren ihren alten Direktor und Lehrer ›Hazrat Jee‹, der viel für die Schule getan habe. Die religiöse Bildung folgt dem Curriculum ›Dars-e-Nizami‹, entwickelt von Mullah Nizam al-Din Sahalwi Lukhnawi, die im Wesentlichen aus dem Memorieren von Rechtstexten, ›Hadith-Sammlungen‹, arabischer Sprache und Koranversen besteht. Mit ausgesprochener Wut und Verachtung blickt ein ehemaliger Schüler, Fadil, auf seine Jahre in dieser Schule zurück: »They wasted five years of my life« klagt er und erzählt über moralische Enge: Kein ›Facebook‹ erlaubt, es sei »fitna« (schwere Versuchung), wegen der dort auch postenden Frauen! Auch Prügel habe es gegeben. Seine Schlussfolgerung:
Die britische Schulbehörde (Offsted) scheint daran keinen Anstoß zu nehmen.
Muslimische Führungseliten und Politik
Der Einfluss der muslimischen Führungseliten aus Moscheen und Schulen auf die lokale und regionale Politik nimmt ständig zu. Zahlreiche Ratsmitglieder kommunaler Gremien (Councillors) sind Muslime und machen Politik in erster Linie für ihre muslimischen communities. Tom und Jane aus Dewsbury beschweren sich bitter, dass ihnen der Stadtrat das Aufziehen des ›Union Jack‹ nicht gestattet hat, in Großbritannien!
Ob Debandis oder Barelwis, es hat sich ein Clan-System ausgebildet, dass freundlich „biraderi“ (brotherhood) genannt wird. Islamistische ›Influencer‹ aus Moscheen wirken auf die lokale muslimische Population ein und verteidigen die Beschlüsse ›ihrer‹ Councillors.
Predigten und islamische Unterweisung
Husain hat viele Predigten gehört, die nach den Ritualgebeten gehalten werden. Meist wird auf Arabisch, Urdu oder Bengali gepredigt, mit englischen Abschnitten, bzw. Übersetzungen. Stets wird der ›Prophet‹ in den höchsten Tönen gepriesen und sein Leben (sira) als exemplarisch für eine fromme Existenz herausgestellt. Ihn zu ehren ist eine unbedingte Verpflichtung der Gläubigen, ihn zu beleidigen ein todeswürdiges Verbrechen. Inhaltlich geht es überwiegend um ethische Fragen (Kleiderordnung, Hygiene, Verhalten von Männern zu Frauen etc.) und um die ›richtige‹ religiöse Praxis. Immer wieder wird die Bedeutung der Familie und die Gehorsamspflicht der Frau gegenüber dem Mann betont. Die Performance reicht von gewinnender Rhetorik bis zu Klagen über das ›laxe‹ Glaubensleben der Muslime und Drohungen mit dem Höllenfeuer. Obwohl es im sunnitischen Islam keinen Klerus gibt, ist die herausgehobene Stellung der Imame frappierend. Willig beugen sich die meisten Gläubigen ihren Aussagen, Ermahnungen und Fatwen. Häufig begegnet Husain die Reaktion, dass bevor eine kritische Frage beantwortet werden kann, erst der Imam gerufen werden muss. In den ›Sharia-Courts‹ haben die Imame und ›Gelehrten‹ das Sagen. Mehrfach kritisiert Husain den hier dominierenden »clericalism« (S. 232). In Moscheen und Schulen wird nicht um Erkenntnis gerungen, gemeinsame Verständigung gesucht oder gar kritische Diskussionen mit pro und contra angeregt. Es geht einzig und allein um die widerspruchslose Verkündigung der Wahrheit des Islam. Für den jungen Imam aus dem ›Dawat-e-Islami Centre‹ in Glasgow ist die Sache ganz klar: »We cannot criticise our religion« (S. 231).
Islamische Literatur
In allen Städten, die Husain besucht, schaut er nach Buchläden mit islamischer Literatur, vorzugsweise angelehnt an Moscheen oder Schulen. Was er dort sieht, ist alarmierend: Die fundamentalistische Literatur der ›frommen Väter‹ (Salafi-O-Ton) dominiert: z.B. Ibn Taimiyya (1263-1328), Abd al-Wahhab (1704-1792) und Ahmed Raza Khan Barelvi (1856-1921), der Gründer der ›Barelwi‹-Bewegung. In Birmingham entdeckt Husain eine schmale Broschüre von ihm mit dem Titel: Western Science Defeated by Islam. Raza kritisiert darin Newton und Einstein und verwirft das heliozentrische Weltbild:
Ferner gibt es Hinweise auf verschiedene Hadith-Werke, wobei das von Mohammed al-Bukhari zusammengestellte (Sahih al-Bukhari, ca. 846), in der islamischen Welt bis heute als die authentischste Sammlung der Aussprüche und Handlungsweisen des ›Propheten‹ gilt. Hier und in anderen Sammlungen sind auch die skurrilsten Anweisungen für das islamische Leben nachzulesen. Und sie werden befolgt. Fast verzweifelt notiert Husain:
Auch ›moderne‹ islamistische Literatur ist zahlreich vorhanden, insbesondere präsent die Chefideologen Sayyid Abu A’la Maududi aus Pakistan, Sayyid Qutb, Ägypten (plus Schriften seines jüngeren Bruder Mohammad), Yussuf al-Qaradawi, Katar und der saudi-arabische Chefwahhabit, Muhammad bin Salih Uthaymin, getreuer Schüler Abd al-Wahhabs. Selbst Schriften des Antisemiten und Homophoben Bilal Philips finden sich. Philips hat Einreiseverbot in Großbritannien und einigen anderen Ländern. Ich erinnere mich, dass er 2009 von der islamistischen Al-Nur Moschee in Berlin-Neukölln zu einem Vortrag eingeladen wurde und ungehindert einreisen durfte. Nach heftigen Protesten sagte die Al-Nur Moschee seinen Auftritt ab. Antisemitismus ist unter britischen Muslimen sehr verbreitet. In Buchläden in Birmingham werden Schriften von saudi-arabischen Autoren angeboten, in denen »the greed and avarice of the Jews« kritisiert werden (S. 175) Selbstkritische Imame sind Husain ganz selten begegnet. In Cardiff äußert sich Imam Zain, der Husains Buch The House of Islam (2018) gelesen hat, immerhin deutlich: Dass solche Literatur angeboten werde, sei »shameful and intolerable…We should ban these books« (S.188).
Verschleierte Frauen und Separation
Schon bei seiner ersten Besuchsstation in Dewsbury sieht Husain keine Frauen in der Moschee. ›Tablighi Jama’at‹ untersagt ihnen das Beten in der Moschee, obwohl sie sich gerade in dieser Frage nicht auf ihren ›Propheten‹ berufen können. Dieser ließ Frauen in einem abgetrennten Bereich mit ihm beten, war aber sonst grundsätzlich der Meinung, dass Frauen zu Hause bleiben sollten (Sure 33, 32). Das bezog sich zu seinen Lebzeiten nur auf seine Frauen, wurde dann aber von den Rechtsgelehrten auf alle Musliminnen ausgeweitet. In anderen Moscheen sind Frauen in Vollverschleierung (hijab, niqab und sogar burka) zwar zugelassen, jedoch nur in abgetrennten Bereichen. In Dewsbury lässt ihn ein Geistlicher wissen, dass die Zulassung von Frauen eine »temptation for many« sei (S.21). Auf Nachfrage wird Husain auf ein Buch verwiesen, in dem der Autor das Problem des »Intermingling with the sexes« rigoros angeht. Die freie Gesellung von Frauen und Männern sei die Ursache für den Untergang der griechischen und römischen Zivilisation gewesen (S. 25). In Birmingham findet Husain ein Benimm-Buch für die muslimische Frau: Gift for a Muslim Bride. Hier wird die Frau belehrt, stets ihrem Gatten alle gestatteten Wünsche zu erfüllen, von dem Irrtum zu lassen, dass sie den Männer gleich oder gar überlegen sei, nicht vor ihrem Mann zu essen und auf keinen Fall ihr Haus zu verlassen, denn »the emergence of the woman from her home is like the emergence of Shaitaan [Satan] himself…«. (S. 148). Der Gründer der Leicester Islamic Dawah Academy bringt es auf den Punkt: »The intermingling of the sexes is an act of sin and totally against sharia« (S. 160). Husain gelingt es nicht, sich mit einer muslimischen Frau alleine zu treffen und Fragen zu stellen. Eine Frau muss stets von einem ›mahram‹ (einem engen Verwandten) begleitet werden. In Manchester trifft Husain Faiza, eine Freundin, mit der er seit 15 Jahren in regem Email- Austausch steht. Natürlich ist ihr ›mahram‹ (in diesem Falle der Ehemann) mit dabei. Sie vermeidet jeden Augenkontakt und gibt ihm auch nicht die Hand (S.33, siehe auch S. 246f.). Umarmen und auf die Wange küssen ist völlig ausgeschlossen, wie Faiza ihm vor dem Treffen noch warnend mitteilt.
Die untergeordnete Stellung der Frauen wird immer wieder sichtbar. Husains weibliche Begleiterinnen werden in Moscheen, Buchläden und bei Gesprächen weitgehend ignoriert. Selten gibt ein Mann ihnen die Hand. Bei seinem Eintritt in die Glasgower Dawat-e-Islami Moschee verlassen kleine Mädchen, alle in schwarze Burkas gehüllt (!), fluchtartig den Raum. Ein Schild verbietet den Eintritt männlicher Personen während der islamischen Unterweisung für die Mädchen (S. 231). Husain gibt vor, seine neun und zwölf Jahre alten Töchter für abendliche Studien anmelden zu wollen und erfährt von einem jungen Mann, dass dafür keine Gebühren anfallen, weil es in Pakistan prominente Gläubige gibt, die ›Dawat-e-Islami‹ unterstützen. [›Dawat‹ ist eine internationale NGO und finanziert weltweit islamische Mission (Da’Wa), J.K.]. Husain fragt nach, ob die Schülerinnen wirklich alle »hijab« oder »burqa« tragen müssen. »This is our uniform«, bekommt er zur Antwort. Aber sie sind doch noch nicht »balighat«? (erwachsen) wendet Husain auf Arabisch ein. Doch sie müssen ihre »private parts« (Arabisch: Satr-e-aurat) bedecken! Husain protestiert: ›Gesicht‹ und ›Hände‹ seien doch nicht »private parts«! Husain bohrt weiter und fragt nach Belegen aus Koran und Sunna. Jetzt ist der junge Mann am Ende seines Lateins. Er will seinen Vater fragen, den Besitzer der Moschee, der sei Geistlicher. Husain resigniert: »Clericalism once again. The need to consult scholars« (S.233).
Najma aus Blackburn, die in ein Frauenhaus geflüchtet ist, erzählt Husain ihre traurige Geschichte. Von einem islamistischen, gewalttätigen Ehemann (Jama’at-al-Islami), der sie mit dem Messer angriff, weil ihr das Kopftuch heruntergefallen war. Deshalb hätten die ›Engel‹ das Haus verlassen. Der Ehemann zwang sie und die Tochter das Kopftuch selbst zur Nacht aufzubehalten. Schließlich floh er nach Pakistan als er von der Polizei wegen Mordversuchs gesucht wurde (S. 101ff.). Diese Geschichte ist exemplarisch. Es gibt wahrscheinlich Tausende britisch-muslimischer Frauen, die Najmas Schicksal teilen. Junge Frauen werden nach islamischem Ritus in Moscheen verheiratet, eine zivilrechtliche Registrierung erfolgt häufig nicht (Eine Ausnahme ist die Moschee in Belfast, wo der ›Shaikh‹ islamische Heiraten (nikah) bei den Behörden registrieren lässt, S. 199). Verheiratungen können sogar in einem bekannten islamischen Buchladen in London vollzogen werden, allerdings mit nur zwei männlichen (!) Zeugen. So gehen junge muslimische Frauen schutzlos in eine oft scheiternde Ehe und müssen sich dann beim ›Sharia Court‹ Hilfe suchen, oft vergeblich. Auch Najma war mehrfach bei Imamen vorstellig geworden, die allerdings stets ihrem Mann Recht gaben. Er sei schließlich das Oberhaupt der Familie und sie müsse sich ihm fügen.
›Liberale‹ Stimmen?
In den Buchläden hat Husain vernunftgeleitete, ›liberale‹ Stimmen vermisst. Wo bleibt die Literatur der Mutazila, fragt er frustriert, wo sind z.B. die Werke von al-Farabi, Ibn Tufayl, Avicenna und Averroes? Wo bleibt die griechische Erbschaft (Aristoteles, Plato etc.)?
Jedoch ist nicht alles ›doom and gloom‹, wie die Engländer sagen. In London trifft Husain Mufti Jalal, stellvertretender Imam einer der größten Moscheen in London und Lehrer eines islamischen Seminars in Luton. Er erklärt frank und frei:
[Anm. des Rezensenten: Die maqāṣid sind die fünf obersten Grundwerte, die ›basalen Rechtsgüter‹ der Scharia: Religion (dīn), Leben (nafs), Vernunft (‚aql), Reinheit der Abstammung (nasl) und Vermögen (māl). Siehe: Adel El Baradie, Gottes-Recht und Menschenrecht, 1983, S. 169)] Jalal ist empört:
Am Ende seiner Reise in London trifft Husain Shaikh Abd-al-Qadir, einen Hadith-Experten. Er fragt ihn, was die drei größten Sorgen seien, mit denen Muslime Hilfe suchend zu ihm kämen. Die Antwort: Drogen, häusliche Gewalt und Frauen, die die Scheidung verlangen! (S. 275). Er schildert geradezu unglaubliche Fälle von Gewalt in der Ehe. Und nachdenklich fügt der Scheich hinzu: »This is not Islam. This is ignorance« (S. 276).
Fazit: Was ist zu tun?
Eine erste Schlussfolgerung lautet: Es ist ein Zeichen von Großbritanniens großer Toleranz, dass es islamisches Leben auf der Insel gibt. Möglich wird dies, weil das Land eine säkulare Gesellschaft ist. Eine zweite ist: »We are becoming separate tribes with different and opposing identities« (S. 282). Er identifiziert drei grundlegende negative Trends: »Communalism, Clericalism, Caliphism«. Muslime definieren sich in erster Linie religiös und ethnisch und grenzen sich von anderen ab. Medressen blühen in Großbritannien und Kleriker schaffen die »religious justification for why and how separate charities, television channels, schools, banks and so on should become more ›Islamic‹« (S. 287). Die ›Geistlichen‹ überwachen das islamische Leben und sorgen für Konformität. Sie organisieren zivilrechtlich nicht registrierte Heiraten, drängen Eltern, ihre Kinder Geistliche werden zu lassen und üben »thought control«. Sie entscheiden, was islamisch und was ›blasphemisch‹ ist. Mit ›Caliphism‹ ist das soziale und politische Ziel gemeint, den säkularen Staat zu untergraben und ein Kalifat zu errichten. Während diese politische Idee in Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinten Arabischen Emiraten auf offene Ablehnung stoße, blühe sie in den muslimischen Gemeinschaften Großbritanniens. Dritte Schlussfolgerung:
Husains Studie ist im analytischen Teil erhellend, informativ, nachdenklich und aufschlussreich. Es tut gut, in dem polarisierenden Lärm religiös-kultureller und ethnischer Konflikte die besonnene Stimme eines gläubigen Muslim zu hören. Er sucht nach einer kollektiven Identität der Briten, gleichgültig woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben und welcher Religion, bzw. Kultur, sie angehören. Er liebt dieses Land, in dem er aufgewachsen ist und in dem er bis heute gerne lebt. Er arbeitet sich an der ›Britishness‹ ab und sucht nach einem inklusiven Patriotismus. Das ist mehr als die berühmte Habermassche Forderung nach einem ›Verfassungspatriotismus‹. »Patriotism … is inclusive and, by definition, focused on love oft he land and it’s institutions – the monarchy, armed forces, rule of law, the NHS [National Health Service, J.K. ] Hinzu müsse der Stolz auf die eigene Geschichte kommen, Hoffnung und Optimismus für die Zukunft des Landes. Selbsthass zerstöre Selbstvertrauen und nationale Identität. Soweit, so gut.
Nach so vielen bedenklichen Entwicklungen im Britischen Islam, den er ›among the mosques‹ entdeckte, geht es ihm zum Abschluss seines Buches um eine historische Positivbilanz des Beitrags der Muslime zu Großbritannien und umgekehrt. Dieser Parforceritt durch die Geschichte fällt denn doch recht holzschnittartig und nicht immer schlüssig aus. Millionen Muslime haben für England und seine Verbündeten im Ersten Weltkrieg gekämpft – gegen den osmanischen Imperialismus. Zweifellos. Dadurch habe Großbritannien Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien zur Freiheit verholfen (S. 294). Hier muss denn doch ein deutliches Fragezeichen gesetzt werden: Großbritannien hat seine eigenen imperialistischen Interessen in diesen Regionen mit Macht und flexibler Diplomatie durchgesetzt. Mehrfach wechselte die Britische Regierung die Seiten. In Ägypten zögerte man lange, den Forderungen ägyptischer Nationalisten nach Unabhängigkeit nachzugeben, unterstützte dann aber die Nationalisten nachdem es zu heftigen Unruhen in den ländlichen Regionen gekommen war und die Lage unübersichtlich wurde. Ohne die britische militärische Intervention wäre es den Nationalisten nie gelungen, das Land im April 1919 unter ihre Kontrolle zu bringen.
Legendär bis heute ist der britische Kolonialoffizier T.E. Lawrence (1888-1935), insbesondere durch das gigantische Filmepos von 1962 Lawrence of Arabia. Dieser sollte auf Weisung des britischen ›High Commissioners‹ in Kairo die arabischen Stämme zum Aufstand gegen die Osmanen aufstacheln. Dem ›Amir‹ von Mekka, Scherif Husayn bin Ali, versprachen die Briten für seine Mithilfe bei der Entfesselung des Aufstands einen arabischen Nationalstaat nach dem Ende des Osmanischen Reiches. Dieses Versprechen konnten sie nicht einlösen, nicht zuletzt auch wegen der endlosen Streitigkeiten im arabischen Lager um das Erbe des geschlagenen Osmanischen Reiches, vor allem um Syrien und Jordanien. Und schon 1916 hatten sich Briten und Franzosen in einem Geheimabkommen über die Aufteilung der Region geeinigt (Sykes-Picot Abkommen, 9. Mai 1916).
Die Behauptung, die ›Freiheit‹ Saudi-Arabiens geschaffen zu haben, ist ebenfalls ein kühner Euphemismus. Das Ergebnis dieser Politik, das in der Gründung des saudischen Staates 1932 gipfelte, ist wahrhaftig keine Empfehlung für die Außenpolitik Großbritanniens in dieser Phase. Schon damals hatten die Briten das vom Herrscher des Stammes Sau’d 1744 geschmiedete Bündnis mit den – in moderner Sprache formuliert – totalitären Wahhabiten weit unterschätzt. Auch gegen die Eroberung Mekkas 1924 durch den Fürsten des sogenannten ›Naġd‹ (Innerarabien), Abd al-Aziz vom Stamme Sau’d, hatte man nichts einzuwenden, obwohl ja der britische Schützling Husayn dadurch vertrieben und brüskiert wurde. Die Herrschaft der Sau’d war bereits vorher mit britischer Finanzhilfe deutlich gestärkt worden (Einzelheiten bei Haarmann, Geschichte der Arabischen Welt, 20024, S. 450 ff.). Die langfristigen Wirkungen dieser Politik waren natürlich nicht vorhersehbar. Husains Lob ist hier jedenfalls nicht angebracht.
So nett die Geschichte von Queen Victoria und ihrer Obsession mit Orient und Muslimen auch ist, es führt kein Weg daran vorbei, die fatale Politik Großbritanniens im Nahen Osten kritisch zu beleuchten. Husain geht dann noch weit in die Geschichte Englands zurück und rühmt Königin Elisabeth I. (1558-1603), die sich dem Papst nicht beugte, in den muslimischen Osmanen »new and willing allies« fand und mit Marokko und Persien Verbindungen einging (S. 295). Aus der Sicht des christlichen Europas, das seit der Eroberung Konstantinopels 1453 in erbittertem Abwehrkampf gegen die imperialistischen Osmanen stand, konnte das nur als Verrat an christlichen Prinzipien gewertet werden. Dass Handel und Wandel mit der islamischen Welt dadurch blühten und die englische Kultur durch manche Neuerung (Architektur, Kleidung, Kaffee, Zucker) bereichert wurde, mag man positiv registrieren. Die Schattenseiten verschweigt Husain allerdings: islamische Piraterie von Osmanen und ihren Verbündeten in Nordafrika, regelmäßige Überfälle auf italienische, französische, spanische, portugiesische und englische Küsten, Mord und Plünderung, Verschleppung von Frauen, Kindern und Männern auf die maghrebinischen Sklavenmärkte (siehe dazu: Giles Milton, White Gold, 2004).
Anerkennenswert ist auch der Beitrag von Muslimen, in erster Linie aus Indien, die in der Britischen Armee im Kampf gegen die Nazis dienten. Die Türkei bot jüdischen Flüchtlingen Zuflucht, auch das muss gewürdigt werden. Leider verliert Husain kein Wort über den berüchtigten Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, einen üblen Antisemiten, Agitator und Führer der palästinensischen Nationalbewegung, der mit den Nationalsozialisten sympathisierte. Bei einem Besuch beim ›Führer‹ 1941 versicherte Hussein ihm die »Bewunderung durch die gesamte arabische Welt« und sagte ihm die Hilfe der Araber gegen drei gemeinsame Feinde zu: die »Engländer, die Juden und die Bolschewisten«. (Klaus-Michael Mallmann/Martin Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz, 2006, S. 105ff.).
Husain ist ein idealistischer Reformer. Es geht ihm um einen Islam, der in Großbritannien heimisch wird: politisch und kulturell. Der sich ›integriert‹. Das moderne Großbritannien sei durch sechs Prinzipien konstituiert, die Muslime anerkennen und zu ihren eigenen machen müssten:
Rule of Law
Individual liberty
Gender equality
Openness
Uniqueness (of Britain as particular und different) (S.298ff.)
Racial parity
Das Ganze heißt dann ›R.I.G.O.U.R.‹, was man vielleicht am besten mit ›zwingender Stringenz‹ übersetzt.
Keine Frage, Husain verdient unseren ungeteilten Respekt, auch wenn ich sehr skeptisch bin, ob es ihm und seinen Gesinnungsfreunden gelingen wird, die seit Jahrzehnten festgefügten fundamentalistischen Lehren und islamistischen Strukturen aufzubrechen. Husain hatte 2008 mit seinem Freund Maajid Navaz die ›Quilliam-Foundation‹ gegründet, die sich als anti-islamistischer ›Think Tank‹ verstand und viele kritische Studien zu Islamismus und politischen Entwicklungen in der islamischen Welt publizierte. Doch es war von Anfang an eine exklusive Intellektuellen-Vereinigung ohne wirkliche Nähe zu den muslimischen Gemeinschaften. Im April 2021 musste Quilliam aufgeben, offiziell wegen der Schwierigkeit, in Corona-Zeiten eine NGO aufrechtzuerhalten. Es war zu erwarten, dass der unfreiwillige Abgang der NGO vom Freudengebrüll ihrer islamistischen Feinde begleitet werden würde. Und nicht nur von diesen. Ein Beispiel von vielen war die Hetze von ›Middle East Eye‹, einer angeblich ›unabhängigen‹, pro-palästinensischen, israelfeindlichen NGO (https://www.middleeasteye.net/news/quilliam-uk-social-media-reacts-islamophobia).
Die Entwicklungen im europäischen Islam sind wenig hoffnungsvoll. Die Unterwanderung des säkularen Staates und die Islamisierung unserer Gesellschaften geht voran. Das abschreckendste Beispiel ist Frankreich, gleich gefolgt von Großbritannien. Auch in Deutschland haben sich seit Jahrzehnten Islamisten verschiedener Couleur breit gemacht und erfreuen sich bester Gesundheit, von blinden Landesregierungen und der Bundesregierung in zahlreichen Fällen auch noch gesponsert. Mit Islamisten ist kein ›Dialog‹ möglich, da mögen die christlichen Kirchen noch so freundlich darum betteln. Ihre Naivität kennt keine Grenzen, das gilt in besonderer Weise für England. Was ist noch möglich? Bestenfalls eine Art ›friedlicher Koexistenz‹ mit Muslimen bei gleichzeitiger scharfer geistiger und politischer Auseinandersetzung mit allen Formen des Islamismus. Das muss von einer rigiden und effektiven Sicherheitspolitik begleitet werden, die der neunköpfigen Hydra immer neu die Köpfe abschlägt. Nur so lässt sich verhindern, dass in zwanzig, dreißig Jahren die grüne Fahne des ›Propheten‹ über Westminster weht und die schwarze des Kalifats über Downing Street No. 10 aufgezogen wird.