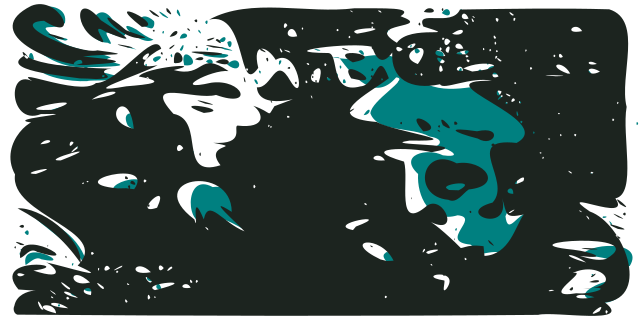von Herbert Ammon
Im Rahmen politischer Bildung der Bundesrepublik, maßgeblich vermittelt durch Nachfahren der Generation der ›Achtundsechziger‹, nimmt das Jahr 1968 in der Nachkriegsgeschichte geradezu mythischen Rang ein. Erst durch die Studentenrebellion sei das ›kollektive Beschweigen‹ (Hermann Lübbe) der NS-Verbrechen in der (west-)deutschen Nachkriegsgesellschaft durchbrochen, die autoritären Strukturen in Staat und Gesellschaft beseitigt und der Weg zu einer tiefgreifenden Demokratisierung des Landes freigeräumt worden. Dank ›1968‹ sei es zu einer ›Neugründung‹ oder ›Zweitgründung‹ der Demokratie in Deutschland gekommen.
Es handelt sich um die historische Selbstwahrnehmung der westdeutschen Bildungseliten. In deren Sicht der Dinge rückt das ›andere 1968‹, die als ›Prager Frühling‹ bekannte Reformbewegung in der Tschechoslowakei – mit Ausstrahlung auf den gesamten Ostblock, nicht zuletzt auf die DDR –, kaum in den Blick. Vielleicht erinnert man sich noch an Alexander Dubček, aber Namen wie Josef Smrkovský, Ždenek Mlynář, Jiří Hájek oder Ota Šik sind in heutigen Diskursen nahezu unbekannt.
Es ist das Verdienst von Peter Brandt und Gert Weisskirchen, ehedem SPD-Bundestagsabgeordneter, mit einem Sammelband an jenes von ihren Protagonisten als ›Sozialismus mit menschlichem Antlitz‹ bezeichnete historische Experiment zu erinnern. Im ›Prager Frühling‹ ging es darum, die nach sowjetischem Vorbild errichtete kommunistische Parteidiktatur mitsamt ihres als ›sozialistisch‹ deklarierten diktatorischen Wirtschaftssystems durch ein freiheitliches Gesellschaftsmodell, gegründet auf nichtkapitalistischer Ökonomie, demokratischer Teilhabe und persönlicher Freiheit, abzulösen. Der ›von oben‹ – von an die Spitze der KSČ gelangten Persönlichkeiten – initiierte, revolutionär anmutende Versuch scheiterte am 21. August 1968 an der Militärintervention der sowjetischen Vormacht und ihrer reformfeindlichen Vasallen im Ostblock.
Die Hintergründe des Prager Frühlings und dessen Ende skizziert Peter Brandt im ersten seiner zwei Beiträge. Zur Vorgeschichte gehört die im Februar 1948 nach einem – von einem erheblichen Teil der Bevölkerung unterstützten – Umsturz errichtete Diktatur der Kommunisten mit dem Stalinisten Klement Gottwald an der Spitze. Unter dessen Regime wurden zahllose Personen hingerichtet, darunter 1952 nach Schauprozessen der Generalsekretär Rudolf Slánský und – als ›bürgerlicher slowakischer Nationalist‹ – der Außenminister Vladimír Clementis. Unter dem1953 an die Macht gelangten Antonín Novotný wurden Anfang der 1960er Jahre – teils infolge einer Wirtschaftskrise, teils im Zuge der 1956 von Chruschtschow eingeleiteten Entstalinisierung – die Zügel gelockert. Eine Parteikommission rehabilitierte Slánský und andere Opfer des Regimes. Wirtschaftsreformer wie Ota Šik dachten über einen ›Dritten Weg‹ – eine Kombination von zentraler Planung und marktwirtschaftlichen Mechanismen – nach. Der Philosoph Radovan veröffentlichte 1966 – parallel zu westlichen Konvergenztheoretikern – ein Buch über Zivilisation am Scheideweg. Wichtige Freiheitsimpulse gingen von der Ende Mai 1963 von Eduard Goldstücker, dem Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes, geleiteten Konferenz zu Franz Kafka aus.
Einen wenig bekannten Aspekt der Reformbewegung beleuchtet der slowakische Politiker und Journalist Peter Weiss in einem aufschlussreichen, bereits im Titel über den Prager Frühling hinausweisenden Aufsatz Der Tschechoslowakische Frühling 1968 und die langen Linien der slowakischen Nationalstaatsbildung. Eine wesentliche Rolle im Vorfrühling 1963-1969 spielte die ›slowakische Frage‹, verwurzelt in den bereits bei der Staatsgründung der Tschechoslowakei gegen Ende des I. Weltkriegs (28.Oktober 1918) überspielten »riesigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Unterschieden« (80). Die in der Vorphase der Staatsgründung, 1915 in Cleveland und 1918 in Pittsburgh, zwischen den Führern der tschechischen und slowakischen Nationalbewegung geschlossenen Abkommen über die Föderation der beiden Staatsgebiete und ihrer Völker wurden in der Zwischenkriegszeit weder unter dem Präsidenten Tomáš G. Masaryk noch unter Edvard Beneš eingelöst, was letztlich zur Abspaltung der Slowakei als Vasallenstaat Hitlers unter Jozef Tiso führte.
Nicht anders ignorierten nach der Wiederherstellung der ČSR sowohl der ›bürgerliche‹ Beneš als auch – nach dem von slowakischen Kommunisten mitgetragenen Februar-Putsch – der Kommunist Gottwald die mit dem Slowakischen Nationalrat, dem Führungsgremium des slowakischen Aufstands im Spätsommer 1944, getroffene Vereinbarung über die föderative Gleichstellung der Slowakei. Fortan »[verband sich] der kommunistische Zentralismus mit dem tschechoslowakistischen.« (101) Einer der engagiertesten Vorkämpfer für eine föderative Ordnung war Gustáv Husák, einst einer der Führer des Nationalaufstandes, der bei den Scheinprozessen gegen die ›slowakischen Nationalisten‹ als einziger die Kooperation mit den Anklägern verweigerte und dafür die Strafe ›lebenslänglich‹ erhielt. Nach seiner Rehabilitierung und Rückkehr in die Politik wurde er – parallel zu Dubček, seinem alsbald erbittertsten Gegenspieler – zum wichtigsten innerparteilichen Opponenten des von »Slowakophobie« (108) beseelten Zentralisten Novotný, der in dieser Phase auch beim sowjetischen Parteichef Breschnew keinen Rückhalt fand (116).
Mit der Anfang Januar 1968 erfolgten Ablösung Novotnýs als Generalsekretär der KP durch den Slowaken Dubček setzte die kurze, stürmische Reformperiode des ›Prager Frühlings‹ ein. Von Beginn an stieß das – im April 1968 von der KP als ›Sozialismus mit menschlichem Antlitz‹ deklarierte demokratische Reformvorhaben im ›sozialistischen Lager‹ auf Ablehnung. Als schärfste Gegner taten sich namentlich SED-Chef Ulbricht in Ost-Berlin, Wladimir Gomulka in Warschau, wo im März 1968 im Zeichen einer antisemitischen Kampagne eine Protestbewegung unterdrückt wurde, sowie Todor Živkov in Sofia hervor. Das ›Neue Deutschland‹ witterte eine neue »politische Offensive des Imperialismus«. (140) Als auch die sowjetische Führung die Entwicklung in der Tschechoslowakei als systemgefährdend einstufte, erwiesen sich alle Rücksichtnahme der Reformer auf die sowjetische Vormacht sowie die Beteuerungen der Bündnistreue als vergebens. Bei einem Treffen im ostslowakischen Čierna nad Tisou Ende Juli drängten die Sowjets – das gesamte Politbüro mit Breschnew an der Spitze – Dubček vergeblich zu einem Kurswechsel. Wenig später, nach einem weiteren Treffen mit Vertretern der Warschauer Pakt-Staaten am 3. August in Bratislava, fiel in Moskau die Entscheidung zur Intervention.
Drei Monate nach der Invasion der Tschechoslowakei durch sowjetische Truppen und ihre Verbündeten verkündete Parteichef Breschnew die nach ihm benannte Doktrin von der ›begrenzten Souveränität sozialistischer Länder‹. Wie schon 1953 in der DDR und 1956 in Ungarn wurde der mit Panzern durchgesetzte Machtanspruch Moskaus im Westen akzeptiert.
Vor diesem Hintergrund ging ab September 1969 die sozialliberale Regierung daran, ihre – auf langfristige Überwindung des Status quo – zielende Ostpolitik ins Werk zu setzen. In ihr sieht Peter Brandt eine gewisse ideelle und konzeptionelle Übereinstimmung mit den Vorstellungen und Zielen der tschechoslowakischen Reformer. Tatsächlich wurde in dem 1957 gegründeten Prager ›Institut für internationale Politik und Ökonomie‹ in Reformzirkeln über eine selbständigere Außenpolitik, über eine – auf Konvergenz zulaufende – Überwindung der Blockspaltung Europas und somit über die ›deutsche Frage‹ im Zentrum nachgedacht, wie aus dem Aufsatz von Libor Rouček, dem Vorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, hervorgeht (Der Prager Frühling, die tschechoslowakische Außenpolitik und die ›deutsche Frage‹) (132-134).
Eine direkte Verbindung zwischen dem Prager Frühling und der Ostpolitik von Bahr-Brandt ergibt sich daraus indes keineswegs. Vielmehr kann das Scheitern des ›Prager Frühlings‹ als Geburtsstunde jener Dissidentenbewegung in der DDR bezeichnet werden, die anno 1989 Massenproteste auslöste und dadurch die Mauer zum Einsturz brachte. In einigen Beiträgen des Buches finden wir die Namen Jaroslav Šabata (1927-2012) und Jiří Dienstbier (1937-2011), dem ersten Außenminister nach der ›samtenen Revolution‹ im November 1989, sowie – in einem erfrischenden, mit Emanzipation nach dem August 1968 übertitelten Interview von 2013 – von Petr Uhl (1941-2021) ehedem mit der Westberliner Trotzkistin Sibylle Plogstedt liiert (und zusammen mit ihr im Dezember 1969 verhaftet und eingesperrt). Zu den drei Genannten, die in den 1980er Jahren – im Zuge der spektakulären ›Nachrüstungsdebatte‹ über nukleare Mittelstreckenraketen in Mitteleuropa – die unbequeme ›deutsche Frage‹ zu Bewusstsein brachten, unterhielten Protagonisten der als ›unabhängige Friedensbewegung‹ firmierenden DDR-Dissidenz engen Kontakt. (siehe dazu u.a.)
Die Herausgeber ordnen den ›Prager Frühling‹ in den mit ›1968‹ assoziierten globalen Zusammenhang von linken Studentenprotesten (Berkeley, Tokio, Berlin) und (national-)revolutionären Bewegungen in der ›Dritten Welt‹ ein. Insbesondere in Weisskirchens Schlussbeitrag 1968 – Aufbrüche und Niederlagen, der erneut die für Deutschland moralisch und historisch befreiende Wirkung von ›Achtundsechzig‹ betont, wird eine Tendenz zur Überhöhung der »Ähnlichkeiten in Ost und West« (257) erkennbar. Dabei sind die Unterschiede in den Protesten gegen den Vietnamkrieg in den USA – etwa bei der mit vier Todesopfern blutig niedergeschlagenen Demonstration an der Kent State University in Ohio – und entsprechenden Protestaktionen an westdeutschen Universitäten nicht zu übersehen. Selbst in den USA ging es der Mehrheit der rebellierenden amerikanischen Studenten in erster Linie um die Beendigung des Krieges in Vietnam, den sozial privilegierten Studenten an der Columbia University hingegen um die Aufhebung von ›Entfremdung‹ in der Massenuniversität und den Hippies um ›flower power‹.
Weit entrückt erscheinen die Kontroversen, die nach der sowjetischen Invasion in der westdeutschen – als Außerparlamentarische Opposition (APO) firmierenden – Protestbewegung ideologisch zwischen moskautreuen Kommunisten, Linkssozialisten und Vertretern der ›Neuen Linken‹ aufbrachen. Ihnen widmet der Historiker Christoph Jünke einen längeren Aufsatz. In Umkehrung des von Wolfgang Fritz Haug, dem Herausgeber der einflussreichen Zeitschrift ›Das Argument‹, geprägten Schlagworts vom ›hilflosen Antifaschismus‹ des bürgerlichen Liberalismus spricht er vom »hilflosen Antistalinismus« all jener westdeutschen Linken, die – wie Haug – gegenüber den brutalen Geschehnissen in der Tschechoslowakei in intellektueller Überheblichkeit meinten: »Es gilt Distanz zu wahren«. (193)
Historisches Faktum bleibt, dass der reformsozialistische Aufbruch in Prag vor allem in der revolutionär erregten westdeutschen Studentenszene nur geringe Beachtung fand. Mit den ›drei M‹ – Marx, Marcuse, Mao – hatten die osteuropäischen Regimegegner wenig im Sinn. »Während junge Menschen in Westeuropa auf den Straßen die Namen kommunistischer Führer wie Mao, Fidel, Che oder ›Onkel Ho‹ skandierten und sie als Helden des antiimperialistischen Befreiungskampfes feierten, versperrte die DDR den Zugang zur chinesischen Botschaft in Ost-Berlin«, schreibt Anna Kaminsky, Vorstandsmitglied der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, in ihrem Beitrag über die Reaktionen in der DDR auf den Prager Frühling. »Während im Westen fernöstliche religiöse und spirituelle Bewegungen Anhänger fanden, wurden in der DDR Kirchen gesprengt, um Platz für die sozialistische Umgestaltung der Städte zu schaffen.« (168f.)
Auf »das andere ›Achtundsechzig‹ in Osteuropa« verweist auch Luciana Castellina, KPI-Mitglied seit 1947, die 1969 als Mitbegründerin der Gruppe il manifesto aus Protest gegen die halbherzige Haltung der KPI gegenüber Moskau mit der Partei brach. Sie erinnert »sich noch, wie erstaunt wir in den Tagen unmittelbar nach dem Einmarsch in Prag über die Reaktionslosigkeit waren, die wir bei einem Großteil der jungen ›Achtundsechziger‹ feststellten.« (252) »Rudi Dutschke war der einzige ›Achtundsechziger‹, der sich für Dubčeks Reformversuch interessierte...«. Wenige Tage vor dem auf ihn verübten Attentat fuhr Dutschke nach Prag, wo er seine Prager Gesprächspartner vor der »Gefahr einer vorübergehenden Überhöhung der bürgerlich-demokratischen Kräfte« und vor einer »Unterwanderung durch antisozialistische Ideen« glaubte warnen zu müssen. (Ibid.) In Italien begriff selbst nach der Selbstverbrennung von Jan Palach (am16. Januar 1969) »keine der Publikationen der Neuen Linken...die Ungeheuerlichkeit des Geschehens«. Der Exilant Jiří Pelikan (1923-1999), als Direktor des tschechoslowakischen Fernsehens ein maßgeblicher Protagonist des ›Frühlings‹, wurde in Rom nur von der Manifesto-Gruppe unterstützt.
Was die unter allen Proklamationen des ›Internationalismus‹ der 1968er Bewegung verdeckten ›nationalen‹ Impulse betrifft, so sind Castellinas Begegnungen mit den radikalen japanischen ›Achtundsechzigern‹ aufschlussreich. Die linksradikalen Zengakuren agierten an den besetzten Universitäten mit rasierklingenverstärkten Bambusstöcken. Sie glaubten, durch einen Akt der Gewalt den historischen Zustand überwinden zu können, der in ihrer uralten Gesellschaft durch eine oberflächliche, von den USA gewaltsam übergestülpte Modernisierung eingetreten sei. Als Weg der Befreiung wählten die Zengakuren – parallel zur westdeutschen RAF – den Weg in den Terror.
Für Jiří Dienstbier war rückblickend ›68‹ eine der schönsten Traditionen unserer modernen Geschichte, schreibt Weisskirchen. Es sei ein Nationen übergreifender Aufstand gewesen, ein »Kampf um die Freiheit«. (281). Weniger optimistisch spricht Castellina – unter Bezug auf Paolo Mieli, ehedem Aktivist der Lotta Continua, heute Präsident der mächtigsten italienischen Verlagsgruppe, zu der der ›Corriere della Sera‹ gehört – von dem verlorenen Glück der damaligen Jugendlichen, aus ihrer Einsamkeit herauszukommen und kollektiv zu handeln. Die »wirkliche Errungenschaft von ›Achtundsechzig‹ [sei] die Entdeckung der Politik und gleichzeitig der Subjektivität [gewesen], die notwendig ist, um sie zu praktizieren.« (255) Angesichts der unter neoliberalen Vorzeichen etablierten Liaison von ›Silicon Valley‹ und Individualismus beklagt sie – ohne zu resignieren – den Verlust jener Erfahrung. Die Erinnerung an den Prager Frühling birgt die Hoffnung auf die Überwindung der auch in der liberalen Demokratie fortbestehenden Diskrepanz zwischen Freiheit und etablierten Machtverhältnissen.