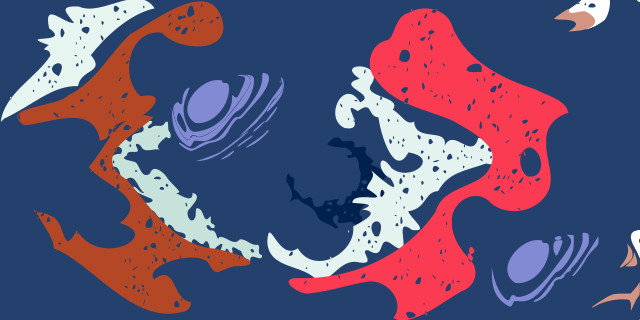von Mario Keßler
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Niederwerfung Nazideutschlands durch die Antihitlerkoalition war der Antifaschismus der zentrale Bezugspunkt aller Strömungen der Arbeiterbewegung – und weit darüber hinaus auch aller bürgerlichen Demokraten. Der Begriff des Antifaschismus wurde, ausdrücklich selbst in der KPD, mit demokratischem Inhalt gefüllt. Die unmittelbare Nachkriegsphase währte jedoch nicht lange: Der Umgang mit dem Erbe des Antifaschismus begann entlang der Frontlinien des aufkommenden Kalten Krieges zu zerfallen.
Antifaschismus und Demokratie fielen auseinander. Vereinfacht gesagt, entstand in Westdeutschland eine allmählich immer besser funktionierende Demokratie, doch zunächst ohne ausreichende Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sprich: ohne ein antifaschistisches Bewusstsein. Der statt dessen aufkommende Begriff des Antitotalitarismus erlaubte mit seiner antikommunistischen Stoßrichtung manchem Funktionsträger des Naziregimes, allzu eilfertig die Gesinnung zu wechseln, war doch der einstige Bolschewistenhass in demokratischem Vokabular nunmehr wieder gefragt.
In Ostdeutschland wurde hingegen der Antifaschismus in seiner parteikommunistischen Form zur Staatsdoktrin erklärt, und es gab somit kaum einen demokratischen Diskurs über die jüngste Vergangenheit, so sehr sich vor allem einige aus dem Exil zurückgekommene Emigranten darum bemühten. Die 1949 gegründete DDR sah sich nicht in der Verantwortung für das Geschehene. Der KPD-Widerstand fand aus ihrer offiziellen Perspektive in der Staatsgründung seine konstruktive Vollendung. Die DDR nahm für sich in Anspruch, den gesellschaftlichen Zustand, der die Nazidiktatur erst ermöglicht hatte, überwunden zu haben. Der nichtkommunistische und der antistalinistische Widerstand fanden, trotz Anstrengungen einzelner Historiker, zunächst nur wenig Beachtung. Auch die Restitution geraubten Eigentums jüdischer Verfolgter auf dem Gebiet der (späteren) DDR wurde, nach anfänglicher Offenheit in einigen Ländern der SBZ, mit der Begründung abgelehnt, die DDR stehe zum Nationalsozialismus – entgegen der Bundesrepublik – in keinerlei historischer Kontinuität. Die neue »sozialistische Eigentumsordnung« mache eine Rückgabe gestohlenen Eigentums unnötig und unmöglich. Mit den Reparationsverpflichtungen an die UdSSR im Rahmen der Übereinkünfte der Siegermächte sei ihrer historischen Verantwortung Genüge getan. Daran änderte die Tatsache nichts, dass 1955 in Moskau dennoch inoffiziell Sondierungen zwischen der DDR und Israel bezüglich de Reparationsfrage stattfanden. Mehr noch: Den Juden wurden zwar attestiert, dass und wie sehr sie gelitten hätten, aber sie hätten nicht gekämpft. Vom jüdischen Widerstand war so gut wie keine Rede (wie damals auch im Westen nicht).
Ein Jahr vor der DDR und der Bundesrepublik, 1948, wurde der Staat Israel gegründet. Nach dem selbst für viele Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiterbewegung unvorhersehbaren und unvorstellbaren historischen Vorgang der geplanten, fabrikmäßig organisierten Vernichtung der Juden durch die Nazis erhielt der Zionismus sogar in den Augen bisheriger Kritiker eine furchtbare Rechtfertigung. Der deutsche Faschismus hatte Sympathien bei vielen europäischen Machthabern, auch demokratisch gewählten Repräsentanten, für sich verbuchen können, doch auch bei jungen Nationalbewegungen – etwa im arabischen oder im indischen Raum. Die Flüchtlingskonferenz von Evian 1938 hatte als Fiasko geendet, Vertreter von 28 Nationen sahen sich nahezu komplett außerstande, irgendetwas für die von den Nazis und ihren Handlangern verfolgten Menschen tun zu können. Es war schlicht zu konstatieren, dass es der globalen Gemeinschaft nicht gelungen war, Millionen europäischer Juden vor der Vernichtung zu schützen und die Flüchtigen zu retten. Der ungeheure Zivilisationsbruch von Auschwitz machte die Gründung einer eigenen Heimstätte für das jüdische Volk zu einer Notwendigkeit, und zwar völlig unabhängig davon, ob sich die Mehrheit der Einwanderer nach Israel als Zionisten verstand oder nicht.
Die SED hatte zunächst – wie die Sowjetunion – die Staatsgründung Israels mit Verweis auf die Erfahrung von Auschwitz begrüßt. Tschechische Waffen, auf Moskaus Geheiß an den jungen Staat geliefert, sicherten ihm gegen den sofort mit der Staatsausrufung begonnenen Angriff seiner arabischen Nachbarn im Unabhängigkeitskrieg wohl das Überleben. Nachdem sich Stalins Erwartungen auf einen neuen Verbündeten im Nahen Osten jedoch nicht erfüllten und das gemäßigt-kapitalistische Israel zudem unter sowjetischen Juden große Sympathie gewann, steuerte der Moskauer Diktator nicht nur einen anti-israelischen Kurs, sondern begann in antisemitischer Manier die sowjetisch-jüdischen Intellektuellen, von denen ihn nunmehr jeder an seinen Erzfeind Trotzki zu erinnern schien, zu verfolgen.
Die von der UdSSR abhängige DDR musste ›nachziehen‹. Sie zog nach. Wie die Tschechoslowakei mit dem Slánský-Prozess sollte auch Ostberlin durch ›Entlarvung‹ von ›Parteifeinden‹ seine Unterordnung unter Moskau zeigen – angesichts der jugoslawischen Revolte gegen die sowjetische Vorherrschaft drängte Moskaus Hoher Kommissar Wladimir Semjonow zur Eile. Ursprünglich ins Fadenkreuz geratene mögliche Kandidaten für einen Prozess wie Alexander Abusch oder Gerhart Eisler – zwei Juden – schieden jedoch aus. Sieben Jahre nach Auschwitz wurde der Nichtjude und ›Prozionist‹ Paul Merker, der sich besonders engagiert für eine ›Wiedergutmachung‹ der deutschen Verbrechen an den Juden eingesetzt hatte, im Dezember 1952 zum Opferlamm. Merkers Forderung nach Entschädigung für im Ausland lebende Juden wurde parteioffiziell mit dem Nazi-Terminus der »Verschiebung von deutschem Volksvermögen« gebrandmarkt. Auch Stalins Tod am 5. März 1953 verhinderte nicht Merkers Verurteilung und Inhaftierung – nunmehr in einem Geheimprozess. 1956 wurde er aus der Haft entlassen, doch nur halbherzig rehabilitiert.
In der DDR blieb das Schicksal Merkers ein Tabu, die Aufarbeitung der eigenen Geschichte beeinflusste das nachhaltig und negativ. Der im eigenen Anspruch nach erste sozialistische Staat auf deutschem Boden bestand jedoch darauf, die Wurzeln von Faschismus und Antisemitismus »mit Stumpf und Stiel« ausgerissen zu haben. Es kam vor, dass aufgrund dessen antisemitische Stereotypen und Vorfälle in der SBZ/DDR – trotz mutiger Thematisierung durch Einzelne – heruntergespielt und relativiert wurden, Jüdinnen und Juden verließen nach wie vor das Land. Sechs von sieben jüdischen Gemeindevorstehern, darunter auch der Kommunist Julius Meyer, hatten bis 1953 der DDR den Rücken gekehrt. Für die offizielle DDR war klar: Mit der Beseitigung der ökonomischen Verhältnisse, die die braune Diktatur ermöglicht hatten, war auch das Thema Antisemitismus ›überwunden‹. Friedhofsschändungen, Beschimpfungen und Verfolgungen hatten ihre Wurzeln ausschließlich in der Vergangenheit oder beim ›Klassengegner‹ im Westen – nicht in den Verhältnissen in der DDR, schon gar nicht in ihrer offiziellen Sicht auf den Staat Israel.
Als die Sowjetunion eine israelfeindliche Position bezog, musste die DDR dies zwar gleichfalls tun. Sie tat es aber mit besonderer, auch abstoßender Vehemenz, hatte sie doch aufgrund des diplomatischen Boykotts durch die engstirnige »Hallstein-Doktrin« der Bundesrepublik ein spezifisches Eigeninteresse an guten Beziehungen zu Israels Feinden in der arabischen Welt. Ägypten und Syrien versprachen die Durchbrechung der diplomatischen Isolation. In der Tat nahm die DDR zu einer Reihe arabischer Staaten – erstmals außerhalb des sozialistischen Lagers – diplomatische Beziehungen auf, nachdem die Bundesrepublik und Israel 1965 den Austausch von Botschaftern vereinbart hatten. So wurde der Feldzug gegen den Zionismus ein bis in die 1980er Jahre hinein aus eigenem Antrieb gepflegter fester Kernbestandteil der »internationalistischen und antiimperialistischen« DDR-Staatsdoktrin – bei gleichzeitiger Überhöhung der »nationalen Befreiungsbewegungen« im arabischen Raum zu »Verbündeten im Kampf gegen Imperialismus und beim Aufbau des Sozialismus«. Letztere wurden von den Staaten des Ostblocks mit Waffen beliefert, ideologisch und politisch aufmunitioniert. Im November 1975 unterstützte die DDR die UN-Resolution 3379, die den Zionismus als eine »Form von Rassismus und Rassendiskriminierung« brandmarkte und verurteilte. In diplomatischen Noten hatte die DDR die Legitimität israelischer Staatlichkeit – und damit die adäquate und notwendige Konsequenz mit Blick auf die deutsche Geschichte von 1933 bis 1945 – nicht immer als einen historischen und unumstößlichen Fakt klar fixiert und betont.
So sehr zum Beispiel die frühzeitige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die DDR zu begrüßen war, so durchgängig kritisch muss im Rückblick das Verhältnis des zweiten deutschen Staates zu Israel gesehen werden. Das Verhältnis zwischen Israel und der DDR war und blieb bis 1989/90 ein Nichtverhältnis, wenngleich das Bemühen der DDR-Partei- und Staatsführung um internationale und nicht zuletzt um die Anerkennung der USA in den späten Jahren ihrer Existenz auf vorsichtige Annäherung an Israel unterhalb offizieller diplomatischer Kontakte hinauslief. In der DDR-Gesellschaft erwachte in diesen Jahren ein neues Interesse an den jüdischen Wurzeln, am jüdischen Erbe und der jüdischen Kultur im Osten Deutschlands. Auf die Eiszeit folgt ein Tauwetter. Angestoßen durch Perestrojka und Glasnost in der UdSSR begann auch in der DDR-Gesellschaft ein neuer und differenzierender Diskurs, der sich von der offiziellen DDR-Position unterschied. Zu nennen ist die Hebraistin Angelika Timm, die mit hohem persönlichen Einsatz die Übersetzung und Drucklegung einer Reihe israelischer Schriftsteller in der DDR ermöglichte, keineswegs nur politisch links stehender Autoren.
Zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen kam es bis zum Ende der staatlichen Existenz der DDR nicht mehr, wenngleich die Regierungen Modrow und de Maizière diesbezügliche Schritte unternahmen – unter Einschluss von Fragen der »Wiedergutmachung« für Auschwitz, also auch der Bereitschaft zur Übernahme vermögensrechtlicher Verantwortung. Die deutsch-deutsche Vereinigung warf ihre Schatten voraus. Am 12. April 1990 verabschiedeten die Mitglieder aller DDR-Volkskammer-Fraktionen – von der DSU bis zur PDS – ein Bekenntnis »zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte und ihre Zukunft«, in dem sie die Juden der Welt und das israelische Volk um »Verzeihung [baten] für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945« in der DDR.
Während die herrschende »Linke« in der DDR – und die SED reklamierte die besten Traditionen der linken deutschen Arbeiterbewegung für sich – keine abweichende Meinung zu politischen Grundfragen zuließ, war dies in der Bundesrepublik anders. Hier hatte sich die SPD von Anfang an zum Fürsprecher möglichst enger Beziehungen zu Israel gemacht – gegen teilweise starke Widerstände der bürgerlichen Parteien mit ihren zahlreichen Ex-Nazis und NS-Funktionsträgern in wiederum hohen Positionen: Globke, Oberländer, Vialon, Gehlen etc. In einem Standardwerk zum Thema hat Constantin Goschler auf die starken Widerstände gegen den Abschluss des Luxemburger Abkommens hingewiesen, so dass dem hier nichts hinzu zu fügen ist.
Hingegen propagierten gerade die Sozialdemokraten in der Bundesrepublik ein Israel-Bild, in dem viel von den Aufbauleistungen, den sozialen Errungenschaften und der neuen Lebensweise im Kibbuz die Rede war. Mit zahlreichen Verfolgten des Nazi-Regimes in Spitzenpositionen – so Kurt Schumacher, Willy Brandt, Herbert Wehner, Heinz Kühn, Herbert Weichmann, Fritz Bauer oder anfänglich auch Wissenschaftlern wie Wolfgang Abendroth und Ossip Flechtheim und später Richard Löwenthal – stand sie, allmählich sogar in israelischen Augen, für ein besseres Deutschland. Wenn SPD-Autoren (oder in ihrem Umfeld aktive Theologen wie Helmut Gollwitzer) über das Verhältnis der Linken zu Israel schrieben, betonten sie, die Zionismus-Analysen der Vorkriegszeit seien obsolet geworden. Die moralische Hypothek verbiete ohnehin fast jede deutsche Kritik an Israel. Es waren ganz vorrangig SPD- und DGB-Politiker, die für erste kulturelle, auch sportliche Kontakte (so der Teilnahme deutscher Mannschaften an der Maccabiade) zum jüdischen Staat sorgten.
Das teilweise idealisierte Israel-Bild brach im Sechstagekrieg vom Juni 1967 zusammen. Einerseits ergriffen insbesondere jüdische Emigranten und Überlebende der nazistischen Todeslager vehement Partei für Israel. Der jüdische Linksintellektuelle, schrieb Jean Améry, sei »kein Linksintellektueller mehr, nur noch ein Jude: Denn hinter ihm liegt Auschwitz und vor ihm vielleicht das seinen Stammesgenossen […] zu bereitende Auschwitz II am Mittelmeer.«
Diese Position fand Unterstützung bei den Spitzen von SPD und DGB wie in den Kirchen. Andererseits geriet die emotionale Solidarität studentischer Linker mit den palästinensischen Opfern des Krieges oft zu einer naiven Schwärmerei für den »antiimperialistischen Befreiungskampf« und die »palästinensische Revolution«, in der die Palästinenser nur noch als ein abstraktes Subjekt der Geschichte gesehen wurden, nicht mehr als eine Gesellschaft mit Klassen und ihren Widersprüchen. Dementsprechend galten Israel als imperialistische Macht und nur diejenigen Israelis als Verbündete, die sich gegen den jüdischen Staat wandten und einen abstrakten demokratischen Einheitsstaat in Palästina den Vorzug gaben – in dem die Juden auf den Status einer nationalen Minderheit reduziert sein würden. Im Falle einiger maoistischer Gruppen, nicht aber der DKP, erwuchs aus diesem Weltbild die Befürwortung antijüdischer Gewaltakte in der Bundesrepublik und Westberlin. Aber die israelkritischen Positionen der Neuen Linken verdichteten sich oft ganz allgemein zu einer antizionistischen Ideologie. Ein abstrakter Faschismusbegriff und ein oft ungenügendes historisches Detailwissen ließen manchen Linken die Einzigartigkeit der nazistischen Judenvernichtung verkennen.
Hingegen stiegen allmählich im bürgerlichen Lager die Sympathien für Israel, zunächst befördert durch die nationale und internationale Aufmerksamkeit für den Einsatzgruppen – wie den Auschwitz-Prozess in der Bundesrepublik und natürlich den Eichmann-Prozess in Israel. In dessen Zusammenhang achtete die Bundesrepublik sehr darauf – selbst durch die Andeutung der Verweigerung von Waffenlieferungen an Israel – dass der Name Hans Globke nicht genannt wurde. Die zunächst besonders in Nordrhein-Westfalen keineswegs liberale und demokratische FDP, die vielmehr dort zum Auffangbecken unverbesserlicher Altnazis wurde, entledigte sich erst in einem längerem und komplizierten Prozess dieses bedrückenden Erbes und damit auch prononciert israelfeindlicher Kräfte. 1969 wurde sie als sozialliberale Kraft zum Partner der SPD in der Koalitionsregierung Willy Brandts. Auch die CDU, nach zögerlichem Beginn selbst die CSU, bekannte sich fast in ihrer Gesamtheit im Verlaufe der 1960er Jahre zum proisraelischen Kurs Konrad Adenauers.
Zwar gab es in der CDU wie der CSU anfangs noch manche Politiker mit einer Nazi-Vergangenheit – letzte prominente Beispiele waren das zumindest nominelle NSDAP-Mitglied Alfred Dregger und besonders Theodor Maunz, der seine rechtsradikale Gesinnung weiter pflegte – , doch konnten diese, selbst wenn sie sich ansonsten bedenklich weit am rechten Rand oder schon außerhalb des demokratischen Spektrums befanden, auch nicht einer nur leisen Antipathie gegen die Juden und selbst gegen den Staat Israel Ausdruck verleihen. Wo sie dies, wie Martin Hohmann, dennoch taten, wurden sie aus der Partei entfernt. Darin waren die politisch konservativen Kräfte mitunter konsequenter als die Linken und zumal die radikale Linke im Westen. Dass auch das bürgerliche Deutschland ökonomisches oder politisches Kalkül im Falle Israels lange über die Staatsvernunft setzte, zeigte sich in der sehr späten Aufnahme diplomatischer Beziehungen, eben erst 1965, was zum befürchteten Abbruch der Beziehungen zur Bundesrepublik von Seiten arabischer Staaten führte. Als auch im Nachhinein sehr bedenklich muss die Tatsache gelten, dass mit Rolf Friedemann Pauls zwar kein Ex-Nazi, aber doch ein Wehrmachtsoffizier und Ritterkreuzträger zum ersten bundesdeutschen Botschafter in Israel ernannt wurde. Stand dafür kein Remigrant oder KZ-Überlebender zur Verfügung, von denen in der DDR so viele Botschafter- und ähnliche Positionen einnahmen? Spätestens seit dem Erscheinen des Buches Das Amt und die Vergangenheit ist es unstreitig, dass alte NS-belastete Seilschaften im Auswärtigen Amt, hohe Beamte, deren bekundete demokratische Gesinnung nun als unglaubwürdig gelten muss, die Hitlergegner, die es auch dort gab, von allen verantwortlichen Positionen fernzuhalten wussten.
Die 1970er Jahre waren von politischen Auseinandersetzungen geprägt, in denen das positive Bild Israels bei Linken, aber auch in Teilen der bürgerlichen Mitte zugunsten einer Aufwertung der Palästinenser verblasste. Sogar der Terroranschlag auf die israelischen Sportler in München 1972 konnte diese Entwicklung nicht aufhalten. Israel erschien zunehmend als ein militärischer Goliath, der wehrlose Palästinenser mit Brachialgewalt um ihre Lebensrechte brachte. Der Regierungswechsel 1977 und die Ministerpräsidentschaft von Menachem Begin mitsamt auch scharfen antideutschen Tönen trug zur weiteren Ausformung eines Negativ-Images bei.
Die israelische Besetzung Südlibanons läutete 1982 eine neue Runde im Verhältnis der westdeutschen Öffentlichkeit zum jüdischen Staat ein. Die mit israelischer Duldung von Haddad-Milizen betriebenen Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Chatila führte nicht nur unter radikalen Linken zu einer Abrechnung, bei der mit Worten wie »Holocaust an den Palästinensern« nicht gespart wurde. »Mögen sich gute Deutsche«, schrieb der Leiter der Münchner Marxistischen Gruppe, »für den Völkermord des III. Reiches verantwortlich fühlen, mehr als die Unterstützung der neudeutsch-israelischen Freundschaft kommt aus diesem Untertanenbewusstsein sicher nicht heraus. An Beirut können die Gewissenswürmer der deutschen Nation studieren, wohin das führt.«
Doch signalisierte dieser Krieg auch einen beginnenden Wandel der Debatten. Dafür verantwortlich waren der Druck seitens progressiver Kräfte des Auslandes, auch israelischer Linker, die zunehmende Relativierung des Holocaust unter der alten und neuen Rechten, die Rückbesinnung auf einen linken Ehrenkodex durch die meisten (nicht alle) Grünen und Mitglieder der Alternativen Liste Berlin sowie eine neue Sensibilität innerhalb der Nach-68er-Generation. Dennoch zeigte die fortwährende affektgeladene Aufrechnung nazistischer Verbrechen mit israelischen Untaten ein weiter ungelöstes Problem unter Linken wie auch Nicht-Linken, das auch mit ihren schwierigen Positionen gegenüber der deutschen Geschichte zu erklären war.
Die Frage der Positionsbestimmung stellte sich nach dem Zusammenbruch des »real existierenden Sozialismus« 1989/90 zunächst für große Teile der Linken selbst innerhalb der SPD dann völlig neu. Der Ruf nach linker Selbstkritik gehörte zu den Merkmalen der deutschen Vereinigung, während das konservative Lager und ein Großteil der Liberalen sich durch den Gang der Geschichte bestätigt fühlten. Der Golfkrieg 1991 wurde, mehr als zunächst ersichtlich, zu einer weiteren Zäsur innerlinker Auseinandersetzungen. Im Sog des Verfalls einstiger linker Gewissheiten mutete die Parteinahme für den Irak auch »wie der verzweifelte Versuch an, gegen die politischen Offenbarungen der Gegenwart elementare Bestimmungen eines linken Selbstbegriffs aufrechtzuerhalten«, schrieb zum Beispiel Dan Diner. Hierzu gehörte das Konzept der »Dritten Welt«, die »gegen den Imperialismus« stand. Die Unterstützung für die als gerecht vorausgesetzten Forderungen aus den früheren Kolonien des Westens schien allein noch linker Opposition gegen den ›Zeitgeist‹ einen Sinn zu geben. Weniger als die blutige Realität am Golf war die Suche nach einer eigenen, neuen Identität und Stabilität der Beweggrund vieler Äußerungen.
Doch kam es dabei auch zu apokalyptischen Weltsichten, die sich mit undifferenzierter Kritik an der vermeintlichen Geldgesellschaft der USA verbanden. Hier liegt die Wurzel eines linken Populismus, der sich auch aus einem unreflektierten Antikapitalismus speiste. Die Kritik an der Geldwirtschaft und am daran geknüpften Vormachtstreben der USA war prinzipiell antiimperialistisch ausgerichtet, doch auch mit Ressentiments verbunden. In ihnen geriet der Staat Israel als bloßer »imperialistischer Militärstützpunkt« zur Ursache allen Übels im Nahen Osten schlechthin (Wohl keiner der Linken, die das Wort vom »imperialistischen Militärstützpunkt« Israel gebrauchten, wusste, dass es von Walter Ulbricht stammte). Solche rasch dahingeworfenen, ideologisch bald verfestigten, doch theoretisch kaum reflektierten Schlagwörter boten, wenn auch nicht immer, Elementen eines Antisemitismus Raum, der jedoch nicht vordergründig rassistisch ausgerichtet war. Vielmehr sah er Israel als alleinigen Profiteur von Krieg und Gewalt im Nahen Osten. Dies unterschlug die Tatsache, dass Israels Bevölkerung zu den Hauptleidtragenden des Konfliktes gehört. Solcher Art eines verkürzten Verständnisses von Imperialismus und Antiimperialismus bot seit den 1990er Jahren die Zeitung Junge Welt zunehmend Raum.
Die Auseinandersetzung mit den »Antiimperialisten« gebar neben einer Reihe notwendiger Widersprüche und Interventionen bald eine neue Strömung unter den Linken, die sich selbst als »antideutsch« bezeichnete. In ähnlich verkürzender materialistischer Analyse wendete sie die antinationalistische Herangehensweise der sozialrevolutionären Arbeiterbewegung während des 1. Weltkriegs zur »Kollektivanalyse«: Auschwitz habe die Deutschen zur Täternation gemacht, gegen dessen fortdauernde, wenngleich verborgene Existenz der Hauptstoß zu richten sei. Eine Kritik an Israel und an dessen Hauptverbündeten, den USA, meine regelmäßig mehr als sie vorgebe. Sie müsse »historisch-materialistisch« als das entschleiert werden, was sie sei, nämlich eine in Wissenschaft gegossene und als Teil des humanitären Diskurses firmierende Abwehrhaltung gegen Juden. Wie strukturell, wenn auch nicht argumentativ, ähnlich die »antideutsche« Position der »antiimperialistischen« ist, wird oft übersehen: Trotz des scheinmarxistischen Vokabulars verzichten beide Lager auf eine materialistische Analyse. Israel, die USA und Deutschland firmieren als kollektiv Handelnde, ohne dass die inneren Widersprüche oder die Beweggründe der verschiedenen Klassen und Interessengruppen präzise analysiert werden. Dass zur Begründung der jeweils eigenen Position immer wieder jüdische Stimmen aus Israel und der »Diaspora« hinzugezogen werden, zeigt auf fatale Weise, was sowohl »Antiimperialisten« wie »Antideutsche« zwar leugnen, doch praktizieren: Sie behandeln Israelis und Juden letztlich als ein Kollektiv, dem gemeinsame Interessen (natürlich dem je eigenen Standpunkt angepasst) unterstellt werden. Dies muss noch keinen Antisemitismus bedeuten, ersetzt aber die präzise Gesellschaftsanalyse durch Konstruktionen. Eine solche gemeinsame Basis scheinbar unvereinbarer Standpunkte erklärt auch das Hinüberwechseln von einer Seite zur anderen, wie das Beispiel Jürgen Elsässers zeigt. Die einstige Ikone »antideutscher« Imperialismuskritik konnte, ohne das eigene theoretische Selbstverständnis grundlegend zu revidieren, zum »Antiimperialisten« werden. Nunmehr entdeckte er Irans Präsidenten Ahmadinedschad als »Vorkämpfer« gegen den US-Imperialismus und seine Helfershelfer (zu denen natürlich Israel gehört). Nur so ist erklärbar, dass Ex-Linke wie Elsässer einen Politiker feiern, der im »eigenen« Land die gesamte Linke brutal unterdrücken lässt. Im Iran sitzen Kommunisten, so sie nicht totgeschlagen worden sind, im Gefängnis, in Israel sitzen sie in der Knesset.
All das ließe sich als Sektengezänk abtun, fänden sich solche Positionen nicht auch innerhalb der Partei Die Linke, der wichtigsten politischen Kraft im linken Spektrum jenseits von SPD und Grünen. Genau darum ging es in den leidenschaftlich geführten Auseinandersetzungen der jüngeren Vergangenheit, in denen sich unter anderem Gregor Gysi, Petra Pau, Stefan Liebich und Klaus Lederer mit nichtsektiererischen und nicht anti-israelischen Positionen hervortaten – und hoffentlich die innerparteilichen Kontroversen für sich entschieden.
So sehr bürgerliche Kreise und demokratische Konservative an der Solidarität mit Israel und an der erklärten Ablehnung des Antisemitismus festhalten: Sind alle Ressentiments gegen Juden völlig ausgeräumt? Wäre Stefan Heym als Alterspräsidenten des Deutschen Bundestages in der CDU/CSU-Fraktion wirklich ein solcher Hass entgegen geschlagen, wenn er nur Marxist und Sozialist und kein Jude gewesen wäre? Damit sei kein pauschaler Antisemitismus-Vorwurf gegen jeden Abgeordneten oder gar die Fraktion als Ganzes erhoben, aber ein erheblicher Mangel an Sensibilität wie an den sonst viel beschworenen Bürgertugenden war es ohne Frage. Mit Ausnahme von Rita Süssmuth verweigerten bekanntlich die CDU/CSU-Abgeordneten jede dem Alterspräsidenten zustehende Ehrenbezeugung nach seiner gewiss nicht aufrührerischen Rede zur Eröffnung des Bundestages 1994 – immerhin einem Mann, der in amerikanischer Uniform gegen Hitler gekämpft und in ganz anderer Weise sich später öffentlich in der DDR gegen die Beschränkung der Meinungsfreiheit und gegen Gesinnungsschnüffelei gewandt hatte. Ebenso muss festgehalten werden, das sich einige Abgeordnete der Partei Die Linke nicht von ihren Plätzen erhoben, als am 27. Januar 2010 Israels Staatspräsident Shimon Peres vor dem Bundestag aus Anlass des Gedenkens der Opfer des Holocaust sprach. Ist ein solches – wie bei der CDU/CSU unter allem Niveau stehende – Verhalten mit dem Verweis auf die israelische Besatzungspolitik zu rechtfertigen oder doch, mindestens teilweise, auch Zeichen tiefer sitzender Ressentiments?
Ein offenes, hier nicht zu vertiefendes Problem bleibt, bis zu welchem Maße einstige, auch antijüdische Stereotype gegenüber dem sogenannten Fremden heute gegen nichtjüdische Migranten gerichtet werden, gegen die eine selbsternannte bürgerliche Mitte wie die Pro-Bewegung in Nordrhein-Westfalen nun Stimmung macht. Doch noch fehlt die Partei zum Buch, zu Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab; und der Verfasser des Bestsellers ist noch immer Mitglied der SPD.
Schließlich: Welche Denkweise von Vertretern des Staatsapparates wird sichtbar, wenn immer mehr herauskommt über die Duldung und das Zusammenwirken der neonazistischen Mörderzelle NSU und Angehörigen von Polizei und Verfassungsschutz? Sind das nur Einzelfälle? Es sind zu viele Einzelfälle, als dass sie als solche noch benannt werden sollten. Zwar sind die unglücklichen Opfer des NSU-Terrors keine Juden, aber: Ist nicht (nach Brecht) der Schoß noch immer fruchtbar, aus dem das kroch?
Zuletzt: Es gibt neben unguten auch gute Gründe, Israels Politik zu kritisieren. Viele Israelis nutzen die in ihrem Land garantierte Meinungsfreiheit und tun dies mit gewichtigen Argumenten. Wer die Besatzungspolitik gegenüber den Palästinensern und besonders deren Auswüchse, die Anmaßung weniger ultraorthodoxer Kreise, ihren Mitbürgern vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, kritisiert, kann und darf dies tun – auch als Deutscher, freilich immer mit dem Bewusstsein um die schreckliche Vergangenheit. Eines aber sollte jede Deutsche und jeder Deutscher sich vorab fragen: Wie lange wohl würde Deutschland, ganz gleich unter welcher Regierung, ein demokratisches Gemeinwesen bleiben, hätte es derart viele äußere Feinde wie Israel?
Anm. d. Red.: Leicht überarbeiteter Vortragstext aus Anlass des 60. Jahrestages des Luxemburger Abkommens am 10. September 2012 in der Deutschen Gesellschaft e.V., Berlin
Ausgewählte Literatur zum Thema:
Améry, Jean: Zwischen Vietnam und Israel. Das Dilemma des Engagements, in: Die Weltwoche (Zürich) vom 9. Juni 1967, und in: Ders., Widersprüche, München 1990, S. 206-213.
Conze, Eckart, Norbert Frei, Peter Hayes und Moshe Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010.
Diner, Dan: Der Krieg der Erinnerungen und die Ordnung der Welt, Berlin 1991.
Gardner Feldman, Lily: The Special Relationship between West Germany and Israel, Boston 1984.
Goschler, Constantin: Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus 1945-1954, München/Wien 1992.
Keßler, Mario: Die SED und die Juden – zwischen Repression und Toleranz. Politische Entwicklungen bis 1967, Berlin 1995.
Kloke, Martin W.: Israel und die deutsche Linke. Zur Geschichte eines schwierigen Verhältnisses, Frankfurt a. M. 1990, erweiterte Neuausgabe 1994.
Müller, Elfriede: Die deutsche Linke auf Identitätssuche – Antisemitismus und Nahostkonflikt, in: Matthias Brosch u. a. (Hg.): Exklusive Solidarität. Linker Antisemitismus in Deutschland, Berlin 2007, S. 405-417.
Sagi, Nana: Wiedergutmachung für Israel. Die deutschen Zahlungen und Leistungen, Stuttgart 1981.
Stern, Frank: Im Anfang war Auschwitz. Antisemitismus und Philosoemitismus im deutschen Nachkrieg, Gerlingen 1991.
Timm, Angelika: Jewish Claims against East Germany. Moral Obligations and Pragmatic Policy, Budapest 1997.
Timm, Angelika: Hammer, Zirkel, Davidstern. Das gestörte Verhältnis der DDR zu Zionismus und Staat Israel, Bonn 1997.
Timm, Angelika (Hg.): Die deutsche Linke und der Antisemitismus. Ausgewählte Zeugnisse der Antisemitismusdebatte in der Partei Die Linke, Tel Aviv 2012 (deutsch und hebräisch).
Vogel, Rolf (Hg.): Deutschlands Weg nach Israel, Stuttgart 1976.